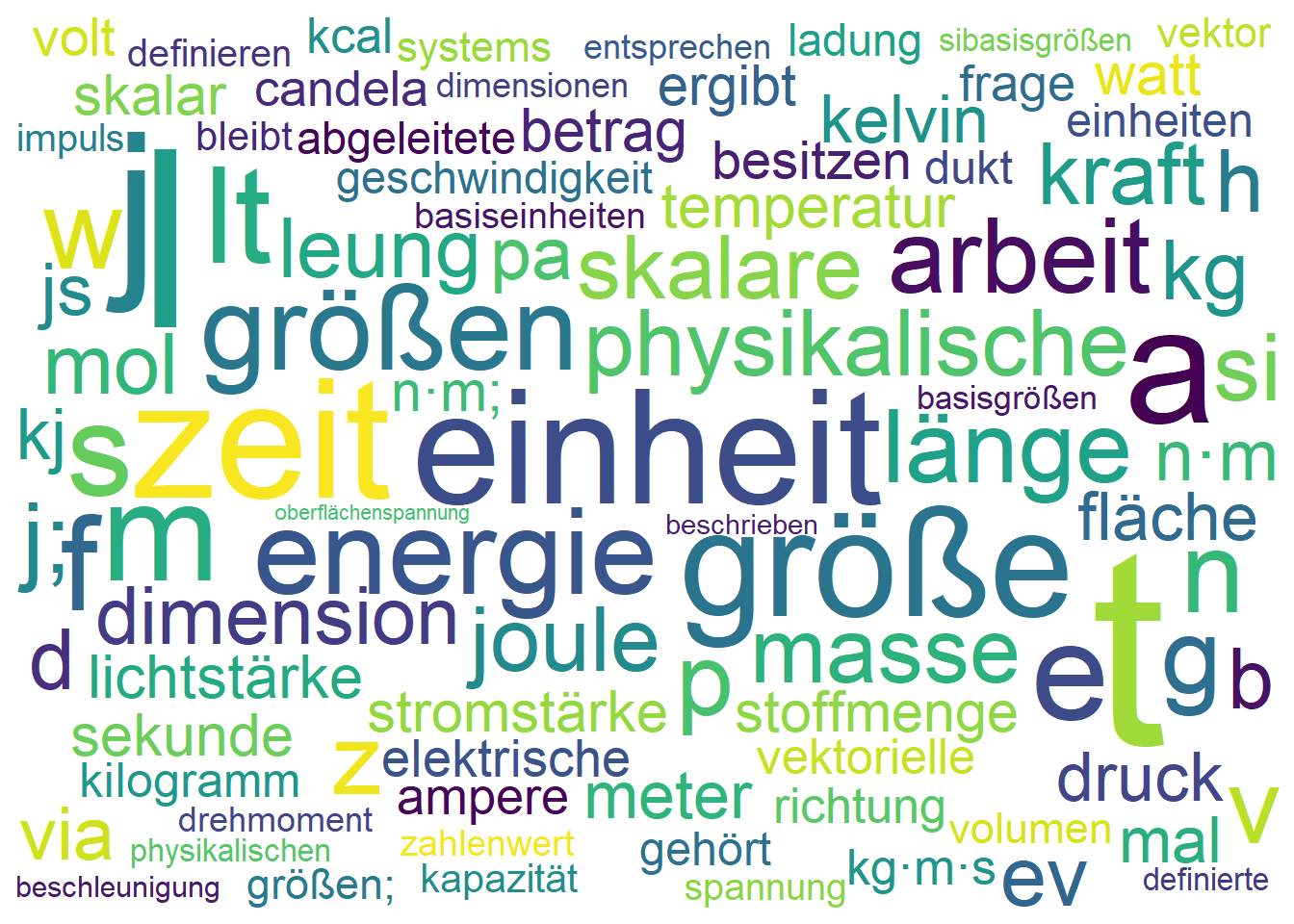Physikalische Größen
IMPP-Score: 1.7
Grundlagen der physikalischen Größen und systematischen Einteilung
Physik begegnet uns überall – egal ob beim Wiegen eines Apfels, beim Backen eines Kuchens oder beim Abschätzen der Fahrtzeit mit dem Auto. Durch praxisnahe Beispiele und mit einem klaren Blick auf Aufgabenstellungen im 1. Staatsexamen (IMPP) machst du dir dieses Thema intuitiv zugänglich.
Was ist eine physikalische Größe?
Immer, wenn du misst, bezeichnest du ein Naturphänomen durch eine Zahl mit Einheit. Ob der Apfel 150 g oder 0,15 kg „wiegt“, das dahinterstehende Phänomen – die Masse – bleibt das gleiche. Eine physikalische Größe ist daher immer als
\[ \text{Größe} = \text{Maßzahl} \times \text{Einheit} \]
darstellbar.
Praxisbeispiel
Wenn du „5 kg Zucker“ kaufst, bedeutet das: 5-mal das abgemachte Kilogramm (kg) an Masse.
Egal ob in Gramm oder Kilogramm: Die Einheit legt nur fest, auf welchen Maßstab du deine Messung beziehst.
SI-Basisgrößen und abgeleitete Größen
Das Internationale Einheitensystem (SI) teilt die Welt der Messungen in sieben Basisgrößen – quasi die Bausteine, aus denen alle anderen Größen zusammengesetzt sind.
| Basisgröße | Symbol | SI-Einheit | Einheitensymbol |
|---|---|---|---|
| Länge | \(l\) | Meter | \(m\) |
| Masse | \(m\) | Kilogramm | \(kg\) |
| Zeit | \(t\) | Sekunde | \(s\) |
| Elektrische Stromstärke | \(I\) | Ampere | \(A\) |
| Temperatur | \(T\) | Kelvin | \(K\) |
| Stoffmenge | \(n\) | Mol | \(mol\) |
| Lichtstärke | \(I_v\) | Candela | \(cd\) |
Diese Basisgrößen sind fundamental, d.h. sie lassen sich nicht aus anderen Größen zusammensetzen.
Beispiele aus dem Alltag:
- \(15\ cm\) (Länge eines Bleistifts)
- \(100\ g\) Tafelschokolade (Masse)
- \(180\ s\) (\(= 3\ min\) Länge eines Songs)
Wichtig für das Staatsexamen:
Nur diese sieben sind wirklich „Basis“ – alle anderen Größen, egal wie gebräuchlich, werden durch Kombination gebildet.
Abgeleitete Größen: Kombinationen der Basisgrößen
Alle anderen physikalischen Größen ergeben sich durch „Rezepte“ aus den sieben Basiseinheiten. Das IMPP fragt häufig, ob du eine Größe als Basisgröße erkennst oder als abgeleitet identifizierst.
- Geschwindigkeit: Weg/Zeit
Einheit \(=\ m/s\), Dimension \(=\ L/T\) - Druck: Kraft/Fläche
Einheit \(=\ Pa = N/m^2\), Dimension \(=\ M \cdot L^{-1} \cdot T^{-2}\) - Energie: Arbeit, z.B. Kraft mal Weg
Einheit \(=\ J = kg\ m^2/s^2\)
Andere Beispiele:
- Oberflächenspannung: Energie pro Fläche (\(J/m^2\) oder \(N/m\))
- Leistung: Energie/Zeiteinheit (Watt \(W = J/s\))
- Kapazität: \(F\) (Farad), abgeleitet aus anderen Basisgrößen
Typische Verwechslungen:
- Gewicht ist eine Kraft, also abgeleitet aus Masse und Beschleunigung.
- Coulomb (elektrische Ladung) entsteht durch Stromstärke mal Zeit.
- Volt (elektrische Spannung), Henry (Induktivität) oder Farad (Kapazität) sind ebenfalls keine Basiseinheiten.
Merke:
Prüfe bei jeder Größe, ob du sie aus den sieben Basisgrößen berechnen kannst – dann ist sie abgeleitet!
Einheit, Maßzahl & Bedeutung
Ganz entscheidend: Die Einheit gibt dem Zahlenwert überhaupt erst Sinn. Schreibst du „30“, aber keine Einheit, weiß niemand, ob du Länge, Zeit oder Energie meinst.
Warum ändern sich Einheit und Maßzahl gemeinsam?
Du kannst jede Größe in verschiedenen Einheiten ausdrücken – solange dein Produkt aus Maßzahl und Einheit gleich bleibt. Das „Naturereignis“ bleibt das gleiche:
- Beispiel: \(100\, \text{cm} = 1\, \text{m}\)
- Bei Flächen: \(1\, \text{m}^2 = 10{,}000\, \text{cm}^2\)
- Bei Volumen: \(1\, \text{m}^3 = 1{,}000,000\, \text{cm}^3\)
Prüfungstipp:
Maßzahl und Einheit verändern sich so, dass das physikalische Phänomen identisch bleibt.
Achtung bei Potenzen:
Beim Umrechnen von Längeneinheiten musst du Faktoren potenzieren:
- \(1\,m^2 = (100\,cm)^2 = 10.000\,cm^2\)
- \(1\,m^3 = (100\,cm)^3 = 1.000.000\,cm^3\)
Präfixe, Einheitensprünge und das „Prinzip dahinter“
Damit Messwerte handlich bleiben, verwendet man Präfixe wie „Milli-“ (\(10^{-3}\)), „Kilo-“ (\(10^3\)), „Mega-“ (\(10^6\)):
- \(1\,kg = 1.000\,g\)
- \(1\,kcal ≈ 4{,}184\,kJ\)
Examen-Hinweis:
Physik bleibt immer gleich, die Einheit ist nur ein Maßstab.
Skalar und Vektor: Hat eine Größe eine Richtung?
- Skalare Größen haben nur einen Betrag: Masse, Zeit, Temperatur, Energie.
- Vektorielle Größen besitzen Richtung und Betrag: Geschwindigkeit, Kraft, Impuls, elektrische Feldstärke.
Beispiel:
- Druck ist skalar, wirkt in alle Richtungen gleich.
- Geschwindigkeit ist vektoriell, hat Betrag und Richtung.
Stell dir die Frage: Kann ich eine Richtung angeben oder wechseln? Wenn ja, ist es ein Vektor.
Darstellung von Maßzahl und Einheit
- Skalare Größen: \(5\,\text{kg}\), \(10\,\text{s}\)
- Vektorielle Größen: \(\vec{v} = (3,4,0)\,\text{m/s}\) (immer Einheit angeben!)
Einheit und Maßzahl definieren gemeinsam die Größe.
Prüf-Trick:
Stimmen die Einheiten auf beiden Seiten einer Gleichung? Erst dann ist die Formel sinnvoll.
Was sind dimensionslose Größen?
Manche Größen benötigen keine Einheit. Sie sind dimensionslos – einfache Zahlenverhältnisse, Anteile oder spezielle Größen wie der Radiant (Bogenmaßwinkel):
- Prozentangaben (z.B. „5 % Zucker“)
- Winkelmaß im Radiant (\(\text{rad} = 1\))
- Stoffmengenanteile, Konzentrationsangaben als Verhältnis
Auch hier: Verhältniszahlen, aber trotzdem eine definierte „Größe“.
Einheit und Bedeutung: Prüfungsrelevante Besonderheiten
Abgeleitete SI-Einheiten und typische Stolpersteine
Viele Prüfungsfragen zielen darauf, ob man eine Größe und ihre Bedeutung korrekt zuordnen kann:
Beispiele:
- Joule (\(J\)): Energie (\(= kg\,m^2/s^2\))
- Newton (\(N\)): Kraft (\(= kg\,m/s^2\))
- Pascal (\(Pa\)): Druck (\(= N/m^2\))
- Farad (\(F\)): elektrische Kapazität
- Henry (\(H\)): Induktivität
- Volt (\(V\)): elektrische Spannung (\(= W/A\))
- Watt (\(W\)): Leistung (\(= J/s\))
Achtung:
Kapazität ≠ Induktivität, auch wenn beide einen Buchstaben als Symbol haben.
Arbeit (\(N \cdot m\)) ≠ Drehmoment (\(N \cdot m\)), auch wenn die Einheit gleich scheint! Arbeit ist skalar (keine Richtung), Drehmoment ist vektoriell (drehrichtungsabhängig).
Im Staatsexamen gerne gefragt:
- Was ist die korrekte Einheit der elektrischen Kapazität? (Antwort: Farad, \(F\))
- Was ist \(H\)? (Induktivität, nicht Kapazität!)
SI-Unterschiede:
Kilokalorie (\(kcal\)) ist traditionsreich, aber keine SI-Einheit. Energie zählt im SI als Joule (\(J\)).
Dimensionenanalyse – Prüfungswerkzeug Nummer 1
Willst du wissen, was für eine Größe du berechnet hast? Schau auf die Dimension dahinter!
- Beispiel: \(g \cdot t^2\)
\(g\) hat die Dimension \(L/T^2\), \(t^2\) die Dimension \(T^2\):
Multipliziert ergibt das \(L\) (Länge).
Also liefert \(g \cdot t^2\) keine Energie, sondern eine Länge!
So lassen sich „unsaubere“ Prüfungsantworten sofort aussortieren: Stimmen die Einheiten und Dimensionen nicht – kann die Gleichung nicht stimmen!
Zusammenfassung & Schlüsselstellen für das Staatsexamen
- Physikalische Größen bestehen immer aus Maßzahl und Einheit.
- Das SI-Einheitensystem beruht auf sieben Basisgrößen – prüfe bei allen anderen Größen, wie sie zusammengesetzt werden.
- Beim Umrechnen mit Potenzen: stets ganz sorgfältig sein! Fläche und Volumen benötigen quadrierte bzw. kubierte Umrechnungsfaktoren.
- Skalar oder Vektor? Schau, ob du eine Richtung mit angeben kannst.
- Einheit = Bedeutung. Auch wenn zwei Größen dieselbe Einheit haben, können sie völlig verschiedene Phänomene bezeichnen.
- Dimensionslose Größen sind reine Zahlenverhältnisse, ihre Bedeutung ergibt sich aus dem Kontext.
- Die Dimensionenanalyse ist ein mächtiges Werkzeug für deine Kontrolle in Aufgaben: Stimmen die Einheiten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass deine Lösung Sinn macht!
Mit diesen Grundlagen kannst du dich im Staatsexamen sicher in Formeln, Größen, Einheiten und ihren Bedeutungen bewegen – und bist gegen typische Stolpersteine gewappnet.
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️