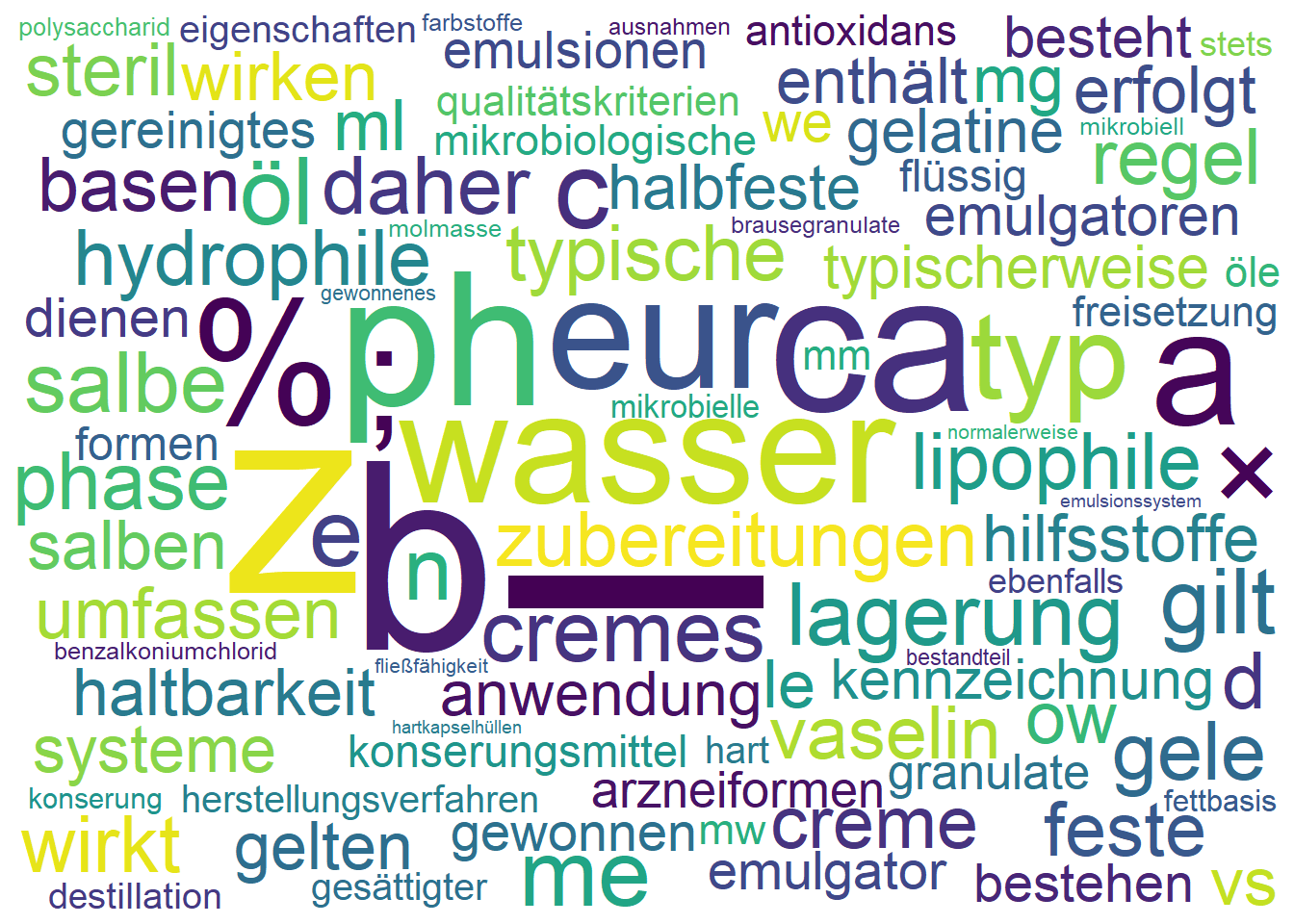Steckbrief der jeweiligen Arzneiform
IMPP-Score: 5.4
Arzneiformen im 1. Staatsexamen Pharmazie
Steckbrief – typische Arzneiformen & ihre Kerneigenschaften
Der Steckbrief-Block liefert dir komprimiert das, was das IMPP besonders gerne abfragt: Definition, Systemtyp, typische Hilfsstoffe, Prüf-/Qualitätsfokus, Anwendung.
Lösung
- Systemtyp: einphasig, molekulardispers; Wirkstoff vollständig gelöst.
- Typische Beispiele: NaCl-Lösung, Hustensirup, wässrige Augentropfen.
- Hilfsstoff-Highlights: Lösungsmittel (Aqua purificata), Puffer, Tonizitätseinsteller, ggf. Konservierung (Mehrdosis!).
- Qualitätsfokus: Klarheit, Gehalt, pH/Isotonie (bei parenteral/ophthalmisch), Sterilität je nach Applikation.
- Anwendung: peroral, parenteral, ophthalmisch, kutan.
Suspension
- Systemtyp: grobdispers, fest in flüssig.
- Beispiele: Antibiotika-Trockensäfte zum Anrühren, Schüttelsuspensionen.
- Hilfsstoff-Highlights: Dispergier-/Benetzungsmittel, Viskositätsbilder, Sedimentationsstabilisatoren.
- Qualitätsfokus: Teilchengröße, Sedimentationsverhalten, Gleichförmigkeit der Dosierung.
- Anwendung: peroral, kutan, ggf. rektal.
Emulsion (O/W, W/O)
- Systemtyp: grobdispers, Flüssigkeit in nicht mischbarer Flüssigkeit.
- Beispiele: Milch (O/W), Hautcremes (O/W/W/O).
- Hilfsstoff-Highlights: Emulgatoren passend zum System (s. unten).
- Qualitätsfokus: Phasenstabilität (keine Aufrahmung/Koaleszenz), Viskosität, mikrobiologische Qualität (wasserhaltig).
- Anwendung: topisch, peroral (z. B. Emulsionsvehikel), selten parenteral (Sonderfall: Lipid-Emulsionen unter strengen Anforderungen).
Paste
- Systemtyp: grobdispers, hoher Feststoffanteil (> 30 %) in halbfester Grundlage.
- Beispiele: Zinkoxidpaste.
- Hilfsstoff-Highlights: Pulver (Zinkoxid etc.), halbfeste Grundlage (lipophil/hydrophil).
- Qualitätsfokus: Homogenität, Verteilbarkeit, Haftung.
- Anwendung: schützend/okklusiv, trocknend bei exsudierenden Hautarealen.
Gel (Hydrogel/Oleogel)
- Systemtyp: kolloiddisperses Netzwerk; Gelbildner + Flüssigkeit/Öl.
- Beispiele: Carbomer-Hydrogele, Oleogele mit Aluminiumstearat/Aerosil.
- Hilfsstoff-Highlights: Gelbildner spezifisch für Wasser oder Öl (s. unten).
- Qualitätsfokus: Viskosität, Homogenität, mikrobiologische Qualität (bei Wasser!).
- Anwendung: topisch, nasal, ophthalmisch (bes. Anforderungen).
Schaum
- Systemtyp: Gasbläschen in Flüssigkeit/halbfest.
- Beispiele: Hautschaum, Zahnschaum.
- Hilfsstoff-Highlights: Treibmittel/Propellant, Schaumbildner/Stabilisatoren.
- Qualitätsfokus: Blasenstabilität, Abgabekonsistenz, mikrobiologische Qualität (bei Wasser).
- Anwendung: schnelle, gleichmäßige Verteilung auf der Haut/Schleimhaut.
Brausegranulat / Brausetablette
- Systemtyp: feste Zubereitung, setzt in Wasser CO₂ frei (Säure + Carbonat/Hydrogencarbonat).
- Beispiele: Vitamin-C-Brause.
- Hilfsstoff-Highlights: Zitronensäure/Weinsäure + Natriumhydrogencarbonat, Aromata, Süßstoffe, Bindemittel.
- Qualitätsfokus: Reaktionsfähigkeit, Feuchteschutz, Gleichförmigkeit von Masse/Gehalt.
- Anwendung: peroral; Compliance-fördernd durch Sprudeleffekt.
Das IMPP fragt regelmäßig Definition, typische Hilfsstoffe, Qualitätsmerkmale und Anwendung der konkreten Arzneiform ab. Steckbriefe gezielt trainieren!
Grundsätzliche Definitionen und Differenzierungen (Arzneibuchlogik)
Phasenlage & Dispersitätsgrad
- Einphasig: alle Bestandteile bilden eine Phase (z. B. Lösungen, einfache Salben).
- Mehrphasig (dispers): mindestens zwei Phasen (z. B. Suspension, Emulsion, Gel, Paste).
- Teilchengröße:
- grobdispers: ≳ 1 µm (optisch erkennbar; Suspension, Emulsion, Paste)
- kolloiddispers: ca. 1 nm–1 µm (Tyndall-Effekt; Gele, Nanosuspensionen)
- molekulardispers: < 1 nm (Lösungen)
Systembegriffe, die das IMPP liebt
- Dispersionsmittel (Außenphase) vs. disperse Phase (Innenphase).
- monodispers/polydispers: einheitliche vs. breite Teilchengrößenverteilung.
- monoform/polyform: gleiche vs. unterschiedliche Teilchenformen.
| Arzneiform | Disperse Phase | Dispersionsmittel |
|---|---|---|
| Suspension | fest | flüssig |
| Emulsion O/W | Öltröpfchen | Wasser |
| Emulsion W/O | Wassertröpfchen | Öl |
| Paste | Feststoff > 30 % | halbfeste Grundlage |
| Hydrogel | Polymernetzwerk | Wasser |
| Oleogel | Polymernetzwerk | Öl |
„Welche Zubereitung ist polydispers?“ – Granulate, Pulver-Mischungen oder viele Pasten sind klassische Kandidaten.
Relevante Hilfsstoffe – Funktionen, Auswahl, Fallstricke
Hilfsstoffe prägen Verarbeitung, Stabilität, Anwendung und Freisetzung. Denke immer: Zur Arzneiform passend wählen.
Emulgatoren (O/W vs. W/O)
- Wollwachsalkohole: bevorzugt W/O, wasseraufnahmefähig, pflegend.
- Polysorbate (Tween): häufig O/W, vielseitig, auch Lösungsvermittler.
- Emulgierender Cetylstearylalkohol Typ A: Komplex für O/W-Cremes.
O/W → leicht abwaschbar, schneller Wirkstoffabgabe; W/O → okklusiv, wasserabweisend. Das fragt das IMPP gezielt im Kontext „Wann O/W, wann W/O?“
Gelbildner – „Architekten“ der Gele
- Wasserbasierte Gele: Carbomer (Neutralisation nötig), CMC-Na, Tragant.
- Ölige Gele: Aerosil (hochdisperses SiO₂), Aluminiumstearat.
Carbomer/CMC funktionieren nur in Wasser, Aerosil/Aluminiumstearat nur in Öl als Gelbildner.
Konservierung (bei Wasser!)
- Sorbinsäure/Kaliumsorbat: vor allem gegen Hefen/Schimmel, sauer optimal.
- Benzoesäure/Natriumbenzoat: schwach sauer, Alternativen zu Sorbat.
- Parabene (Methyl-/Propyl-): breites Spektrum, oft im Kombigebrauch.
- Benzalkoniumchlorid: kationisches Tensid, v. a. äußerlich/nasal/ophthalmisch (Kompatibilität prüfen!).
Merke: Anhydre Salben (Vaselin, Paraffin) oder reine PEG-Basen brauchen i. d. R. keine Konservierung – kein Wasser, kein Keimwachstum.
Antioxidantien (Schutz vor Oxidation)
- Hydrophil: Ascorbinsäure; Komplexbildner (EDTA/Citrat) gegen Metallkatalyse.
- Lipophil: Tocopherol, BHT – Schutz in Fetten/Ölen.
Radikalfänger (z. B. Tocopherol) vs. Komplexbildner (EDTA): unterschiedliche Wirkmechanismen, die das IMPP explizit gegeneinander stellt.
Fließ- & Bindemittel (v. a. Granulate/Tabletten)
- Fließmittel: hochdisperses SiO₂ (Aerosil), Talkum.
- Bindemittel: Stärke, Povidon (PVP), CMC-Na.
Weichmacher & Füllstoffe
- Weichmacher: PEG (auch in Kapselhüllen).
- Füllstoffe: Lactose, Stärke; beeinflussen Fließverhalten, Kompressibilität.
| Applikationsform | Typische Hilfsstoffe | Wichtige Effekte |
|---|---|---|
| Cremes/Gele | Emulgatoren, Gelbildner, Konservierer | Viskosität, Stabilität, Keimschutz |
| Zäpfchen | Hartfett, PEG, Emulgatoren | Schmelzen vs. Lösen, Freisetzung |
| Kapseln | Gelatine, Glycerol (Weichmacher), Füllstoffe | Zerfall/Öffnung, Inhaltsgleichheit |
| Granulate | Povidon/Stärke, Aerosil/Talkum | Dosiergenauigkeit, Fließfähigkeit |
| Macrogolsalbe | PEG 300/1500 | wasserlöslich, hygroskopisch |
Besonderheiten der Arzneiform – praxisrelevante Knackpunkte
- Wasserhaltig = Keimrisiko: Konservierung oder sterile Herstellung notwendig (abhängig von Applikation).
- Fette/Öle = Oxidationsrisiko: Antioxidantien + Licht-/Sauerstoffschutz.
- PEG-Basen: hygroskopisch, können austrocknend wirken (Haut/Schleimhaut).
- Einzeldosis vs. Mehrdosis: Dosiergenauigkeit vs. Kontaminationsrisiko. Einzeldosen (Kapseln, Sachets, Zäpfchen) → Fokus Gleichförmigkeit; Mehrdosen (Cremetiegel) → Fokus Homogenität & Keimsicherheit.
Augen-Zubereitungen müssen immer steril sein; Mehrdosis-Augentropfen i. d. R. zusätzlich konserviert (Ausnahmen: Einmalbehältnisse/konservierungsmittelfreie Systeme).
Herstellungsverfahren – was, warum, wie
Schmelzverfahren (v. a. halbfeste Basen, Zäpfchen)
- Schonende Temperaturführung (Wasserbad); hitzeempfindliche Stoffe schützen.
- Hartfett-Spezial: Volumenkontraktion beim Erstarren → Formen leicht überfüllen/Ersatzzahlen beachten, um Hohlräume zu vermeiden.
Dispergieren/Emulgieren
- Reihenfolge: kleine Phase langsam in große Phase einarbeiten.
- Stabilisierung: geeignete Emulgatoren/Viscosifier; ausreichende Scherung.
- Suspensionen: Feinverteilung (Verreiben/Levigation) sichert Dosisgleichheit.
Fehlreihenfolge → Klümpchen/Phasentrennung. Standardtipp fürs Staatsexamen: „Weniger in Mehr“ unter kräftigem Rühren.
Granulierung
- Feuchtgranulierung: Befeuchten, Kneten, Sieben, Trocknen.
- Trockengranulierung: für feuchte-/wärmeempfindliche Wirkstoffe.
- Krustengranulierung: Bindemittel kristallisieren als „Krusten“ aus.
- Ziele: staubarm, fließfähig, dosiergenau, definierte Auflösung (z. B. Brause).
Gelbildung
- Hydrogele: Gelbildner dispergieren, ggf. Neutralisation (Carbomer).
- Oleogele: SiO₂/Al-stearat im Öl dispergieren; Lufteinschlüsse minimieren.
Sterile Zubereitungen
- Sterilfiltration (0,22 µm) für hitzeempfindliche Lösungen.
- Aseptische Technik: Werkbank, sterile Geräte/Behältnisse, validierte Filter.
Qualitätskriterien inkl. mikrobieller Qualität
Typische Prüfschwerpunkte (technologisch)
- Gehalt & Gleichförmigkeit (Einzeldosen: Kapseln, Zäpfchen, Sachets).
- Homogenität/Konsistenz (Mehrdosen: Cremes/Gele/Salben).
- Teilchengröße/Verteilung (Suspension/Emulsion).
- Viskosität/Fließeigenschaften (Gele, Cremes, Pasten).
- Zerfalls-/Auflösungsverhalten (Granulate/Tabletten).
- Reinheit/Restfeuchte (v. a. Granulate).
Mikrobiologische Anforderungen
- Sterilitätspflicht: ophthalmisch, parenteral, auf geschädigter Haut/Schleimhaut.
- Konservierung: bei wasserhaltigen Mehrdosen fast immer nötig.
- GMP-Hygiene: Flächen, Geräte, Personal; Dokumentation; Kreuzkontamination vermeiden.
Häufige Frage: Für welche Arzneiformen ist die Gleichförmigkeit von Masse/Gehalt verpflichtend?
Typisch: Kapseln, Suppositorien, Sachets (Brausegranulat), Vaginalsuppositorien.
Primärverpackung
- Lichtschutz: Braunglas/Kunststoff mit UV-Schutz für lichtempfindliche Wirkstoffe.
- Sauerstoff-/Feuchtesperre: dicht schließende Flaschen, Blister mit Barrierefolie (Alu/Alu), Trockenmittelbeutel.
- Spezialsysteme: Augentropfen-Mehrdosis mit Sterilfilter oder konservierungsfrei mit Einmalbehältnissen.
- Brausegranulate: trocken, luft- und feuchtigkeitsdicht (sonst Vorreaktion!).
Dosierung
- Einzeldosen sichern Dosiergenauigkeit (Kapseln, Sachets, Zäpfchen).
- Mehrdosen erfordern Anwenderhinweise (z. B. Aufrühren von Suspensionen; hygienische Entnahme aus Tiegeln).
- Pädiatrie: Dosisanpassung nach KG/KOF; Granulate/Suspensionen für flexible Dosierung.
- Topische Anwendung: Schichtdicke/Fläche; O/W/ Hydrogel bei nässenden Läsionen (kühlend, wasserabgebend), W/O/Paste bei trockener/irritierter Haut (okklusiv, schützend).
Wasserhaltige Mehrdosen (Cremes/Gele) nach Anbruch deutlich kürzer haltbar – Aufbrauchfrist auf Etikett/Info vermerken.
Kennzeichnung
- Pflichtangaben: Name/Arzneiform, Wirkstoff(e) + Menge, Herstelldatum, Haltbarkeit/Aufbrauchfrist, Lagerhinweise (z. B. „kühl“, „vor Licht schützen“), ggf. Steril/Konservierung.
- Anwendungshinweise: „Vor Gebrauch schütteln“ (Suspension), hygienische Entnahme (Spatel bei Cremes), Einzeldosis vs. Mehrdosis.
Lagerung
- Temperatur: je nach Formulierung (kühl/RT); keine unnötige Wärme (Oxidation, Trennungen).
- Lichtschutz: bei empfindlichen Wirkstoffen obligatorisch.
- Feuchteschutz: PEG-Basen/ Brausegranulate/ hygroskopische Hilfsstoffe luftdicht.
- Sterile Zubereitungen: nach Anbruch begrenzte Standzeit; aseptische Handhabung.
Haltbarkeit
- Rezeptur meist Wochen bis wenige Monate (deutlich kürzer als Industriestandards).
- Limitierende Faktoren: Wasser (Keime), Fette/Öle (Autoxidation), Hydrolyse empfindlicher Wirkstoffe, Hygroskopie (PEG).
- Stabilisierungsstrategien: Antioxidantien, pH-Einstellung/Puffer, Komplexbildner, Barriere-Primärpackmittel, konsequenter Feuchte-/Licht-/Sauerstoffschutz.
Biopharmazeutische Aspekte – Freisetzung, Resorption, klinische Relevanz
Grundidee
Biopharmazie erklärt, wie die Arzneiform die Freisetzung und Aufnahme bestimmt – und damit Wirkeintritt und Wirkstärke.
Freisetzungslogik je Form
- Lösungen: sofort verfügbare Moleküle → schneller Wirkeintritt.
- Suspensionen: abhängig von Teilchengröße (kleiner → größere Oberfläche → schnellere Lösung).
- Emulsionen: O/W geben lipophile Wirkstoffe oft schneller an die Haut ab als W/O; Emulgator beeinflusst Penetration.
- Gele: Hydrogele (wasserhaltig) → schnelle Abgabe hydrophiler Wirkstoffe; Oleogele → langsamere Abgabe lipophiler Wirkstoffe.
- Zäpfchen:
- Hartfett schmilzt → Freisetzung im lipophilen Schmelzfilm.
- PEG-Basen lösen sich → Freisetzung über Auflösung (feuchte Umgebung begünstigt).
- Hartfett schmilzt → Freisetzung im lipophilen Schmelzfilm.
- Granulate/Brause: schnelle Dispergierung/Auflösung; CO₂ fördert Rühr-/Mischeffekt im Glas → zügige Resorption peroral.
Steuerfaktoren
- Teilchengröße: je kleiner, desto schneller (IMPP-Klassiker).
- Löslichkeit/Polymorphie: amorph > kristallin in Lösungsgeschwindigkeit.
- Hilfsstoffe: Emulgatoren, Viskositätsregler, Penetrationsförderer (Nutzen vs. Irritation).
- Verpackung/Handhabung: Einzeldose = präzise Dosis; Mehrdosis = Keimrisiko → Konservierung/Anwendungstechnik.
Praxisbrücken
- O/W-Creme/Hydrogel bei nässenden Läsionen (kühlend, wasserabgebend, schnelle Freisetzung).
- W/O/Paste bei trockener/irritierter Haut (okklusiv, Protektion, langsamere Freisetzung).
- Macrogolsalbe auf Schleimhäuten möglich, aber austrocknend → Indikation kritisch abwägen.
„Schmelzen vs. Lösen (Zäpfchenbasen)“, „Teilchengröße & Bioverfügbarkeit“, „O/W vs. W/O – Einfluss auf Freisetzung & Anwendung“.
Kurzfazit – Denke in Systemen, nicht in Einzelbegriffen
- Wie viele Phasen? (ein- vs. mehrphasig)
- Welche Teilchengröße? (molekular/kolloid/grobdispers)
- Welche Hilfsstoffe passen zum Medium? (Wasser vs. Öl; Emulgator/Gelbildner)
- Welche Risiken dominieren? (Keime, Oxidation, Hydrolyse, Hygroskopie)
- Welche Konsequenz für Praxis & Staatsexamen? Sterilität/ Konservierung, Dosisgleichheit, geeignete Primärverpackung, richtige Anwendung.
Wenn du diese Kette beherrschst, kannst du jede Altfrage sauber herleiten – und in der Rezepturpraxis sicher und reproduzierbar arbeiten.
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️