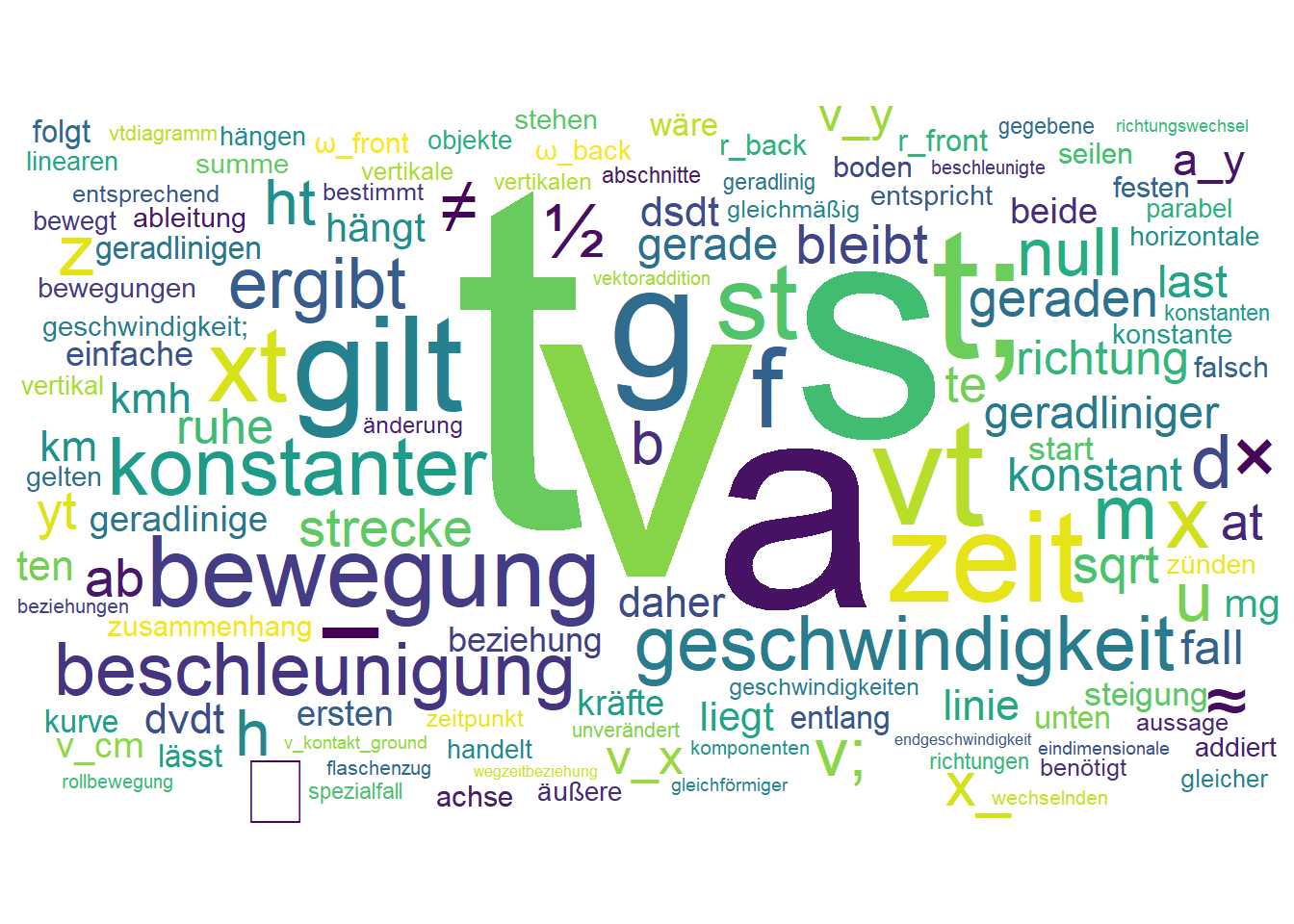Geradlinige Bewegungen
IMPP-Score: 2.1
Grundbegriffe und kinematische Gleichungen der geradlinigen Bewegung
Was ist eine geradlinige Bewegung?
Stell dir ein Auto vor, das auf einer vollkommen geraden Landstraße fährt – keine Kurven, kein Abbiegen, einfach nur vorwärts oder rückwärts auf einer Achse. Oder einen Ball, der gerade nach unten fällt – er bewegt sich entlang einer Linie auf einer einzigen Achse. Bei einer geradlinigen Bewegung beschreiben alle Größen – Weg, Geschwindigkeit und Beschleunigung – nur, was auf dieser einen Bahn geschieht.
Die grundlegenden Größen: Weg, Geschwindigkeit, Zeit und Beschleunigung
Weg (\(s\)/\(x\))
Der Weg gibt an, wie weit sich ein Objekt entlang seiner Strecke bewegt hat, etwa wie die Kilometeranzeige im Auto.
Geschwindigkeit (\(v\))
Die Geschwindigkeit sagt dir, wie schnell sich etwas bewegt – also wie viel Weg pro Zeiteinheit zurückgelegt wird.
Zeit (\(t\))
Die Zeit ist die Messgröße dafür, wie lange ein Bewegungsprozess dauert.
Beschleunigung (\(a\))
Mit Beschleunigung misst du, wie sich die Geschwindigkeit eines Objekts pro Zeitintervall verändert. Trittst du z. B. im Auto aufs Gas, steigt deine Geschwindigkeit pro Sekunde – das ist Beschleunigung.
Arten der geradlinigen Bewegung und ihre Bedeutung im Staatsexamen
Im 1. Staatsexamen in Pharmazie, insbesondere im Physikteil, fragt das IMPP immer wieder nach den beiden wichtigsten Bewegungsarten auf der Geraden:
Gleichförmige Bewegung (konstante Geschwindigkeit, \(a=0\))
Hier fährt das Auto mit gleichbleibender Geschwindigkeit, wie mit Tempomat auf der Autobahn.
- Formel:
\[s = v t\] - Für den Spezialfall Ruhe gilt \(v=0\): Das Objekt bleibt an Ort und Stelle.
Gleichmäßig beschleunigte Bewegung (konstante Beschleunigung, \(a\neq0\))
Beispiel: Eine Straßenbahn fährt gleichmäßig an, die Geschwindigkeit wächst konstant.
- Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz:
\[v = v_0 + a t\] - Weg-Zeit-Gesetz:
\[s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}a t^2\]
Beim freien Fall ist die Beschleunigung \(a = g\) (Erdbeschleunigung, ca. 9,8 m/s²). Lässt du einen Ball aus der Hand los (\(v_0 = 0\)), dann gilt:
\[s = \frac{1}{2}g t^2\]
Achte in Aufgaben auf die Startwerte \(s_0\) und \(v_0\): Sie geben an, von wo und mit welchem Tempo das Objekt startet.
Kinematische Diagramme anschaulich lesen
s-t-Diagramm (Weg-Zeit)
- Gleichförmige Bewegung: Gerade Linie; konstante Steigung entspricht der Geschwindigkeit.
- Gleichmäßig beschleunigte Bewegung: Parabel; der Weg nimmt mit \(t^2\) zu, nicht linear.
v-t-Diagramm (Geschwindigkeit-Zeit)
- Gleichförmige Bewegung: Horizontale Linie.
- Gleichmäßig beschleunigte Bewegung: Gerade mit Steigung – Geschwindigkeit wächst linear.
Im \(s\)-\(t\)-Diagramm steht eine Gerade für konstante Geschwindigkeit (\(a=0\)), eine Parabel für Beschleunigung. Letztere zeigt, dass Weg und Zeit quadratisch zusammenhängen.
Startwerte, additive Bewegungen & das Superpositionsprinzip
Körper können zu unterschiedlichen Zeiten, mit verschiedenen Startgeschwindigkeiten oder aus verschiedenen Startpositionen losfahren. Das IMPP prüft häufig solche Fälle.
- Beginnt die Bewegung nicht bei Null, sind \(s_0\) und \(v_0\) in der Gleichung einzusetzen.
- Mehrphasenbewegungen: Teilwege oder Zeiten (z. B. langsam und schnell, verschiedene Richtungen) werden separat berechnet und aufsummiert. Das Superpositionsprinzip besagt: Bewegungen in unterschiedlichen Richtungen (oder Abschnitte nacheinander) werden getrennt analysiert und anschließend kombiniert.
Das IMPP prüft gezielt ab, ob du \(s_0\) (Startort) und \(v_0\) (Startgeschwindigkeit) richtig einsetzt. Beginnt eine Bewegung nicht am Nullpunkt oder aus Ruhe, müssen diese Startwerte immer berücksichtigt werden.
Anschauliche Beispiele
- Freier Fall:
Ein Ball fällt aus \(s_0 = 0\) mit \(v_0 = 0\): \(s = \frac{1}{2}g t^2\). - Auto fährt von einer Ampel los:
Start am Nullpunkt, anfangs in Ruhe. Die gleiche Formel \(s = \frac{1}{2} a t^2\) passt.
Je länger die Zeit, desto stärker wächst der zurückgelegte Weg bei konstanter Beschleunigung (weil \(t^2\)). Nach 2 Sekunden ist der Weg viermal so groß wie nach 1 Sekunde – daran kannst du die wachsende Wirkung der Beschleunigung gut erkennen!
Die wichtigsten Fakten im Überblick
- Null-Beschleunigung (\(a=0\)): Geschwindigkeit bleibt, wie sie ist.
- Konstante \(a\neq0\): Geschwindigkeit wächst oder sinkt linear; Weg wächst quadratisch.
- Richtungswechsel: Achte auf die Vorzeichen: Negatives \(v\) oder \(a\) bedeutet entgegengesetzte Richtung.
- Ruhe: Spezialfall der gleichförmigen Bewegung mit \(v=0\).
- Teilstücke: \(t = s/v\) kann für jeden Abschnitt einzeln angewandt und die Zeiten addiert werden.
Das Staatsexamen stellt gerne Aufgaben mit mehreren Bewegungsabschnitten, geänderten Startbedingungen oder Richtungswechseln. Überlege immer, auf welche Formel die Aufgabe hinausläuft und wo spezielle Anfangswerte und Richtungen ins Spiel kommen!
Bedeutung der Achsen und Symbole
- \(s_0\): Anfangsort
- \(v_0\): Anfangsgeschwindigkeit
- \(a\): Beschleunigung (meist konstant)
- \(g\): Erdbeschleunigung (Spezialfall)
- \(t\): Zeit seit Beginn
Zusammenfassung: Warum ist das so wichtig?
Wer die Grundlagen der geradlinigen Bewegung und ihre Gleichungen sicher beherrscht und nicht nur stur Formeln verwendet, ist bestens für die Anforderungen im Staatsexamen aufgestellt. Stell dir reale Situationen vor und überlege immer: Wer startet wie? Mit welchem Tempo? Mit oder ohne Beschleunigung? Mit diesen Fragen findest du schnell zur passenden Methode und Lösung.
Verständnis und Anwendung der Bewegungsgesetze bei konstanter Beschleunigung
Was bedeutet konstante Beschleunigung?
Stell dir vor, ein Spielzeugauto wird gleichmäßig geschoben, oder ein fallender Ball wird durch \(g\) konstant schneller. Sobald die Beschleunigung konstant bleibt (also keine Schwankungen auftreten), gelten die Formeln der gleichmäßig beschleunigten Bewegung. Nur dann ist die folgende Mathematik gültig!
Die zentralen Bewegungsgleichungen auf einen Blick
Diese drei Formeln sind das Rückgrat aller Aufgaben:
- Geschwindigkeit-Zeit-Gesetz:
\[v = v_0 + a t\]- Geschwindigkeit wächst pro Zeitintervall gleichmäßig.
- Weg-Zeit-Gesetz:
\[s = s_0 + v_0 t + \frac{1}{2}a t^2\]- Weg wächst anfangs durch die Startgeschwindigkeit und zusätzlich durch die Beschleunigung (immer schneller, weil \(t^2\)).
- Geschwindigkeit-Weg-Gesetz:
\[v^2 = v_0^2 + 2a(s-s_0)\]- Verbinde Geschwindigkeit und zurückgelegten Weg direkt, ohne die Zeit zu kennen (z. B. bei Bremswegen und freien Fallhöhen relevant).
Intuitiv gilt:
- Für \(a=0\) vereinfacht sich alles zur gleichförmigen Bewegung.
- Ist \(v_0=0\) und \(s_0=0\), bleiben nur die „Beschleunigungs-Terme“ übrig.
Wie ändern sich Geschwindigkeit und Weg im Zeitverlauf?
Beispiel: Stein fällt vom Turm (\(g\) konstant):
- v-t-Diagramm: \(v\) steigt gleichmäßig (Gerade).
- s-t-Diagramm: \(s\) nimmt quadratisch zu (Parabel).
Selbst kleine Fehler bei der Zeitmessung (\(\Delta t\)) wirken sich, wegen \(s\propto t^2\), doppelt stark auf die Unsicherheit in \(g\) aus. (Relative Fehler in \(g\) etwa \(2\Delta t/t\).)
Weil der Weg \(s\) quadratisch mit \(t\) wächst, wirken sich Messfehler bei \(t\) viel stärker aus als bei \(s\). Das IMPP setzt solche Fallen gerne!
Beispiele: Schritt für Schritt
Freier Fall aus Ruhe:
Gegeben: \(s\), \(a=g\), \(v_0=s_0=0\). Gesucht: \(t\).
\[t = \sqrt{\frac{2s}{g}}\]
Bremsweg:
Auto bremst von \(v_0\) auf \(0\) mit konstanter negativer Beschleunigung \(a\).
\[t = -\frac{v_0}{a}\]
\[s = -\frac{v_0^2}{2a}\]
Achte stets auf das korrekte Vorzeichen von \(a\) (beim Bremsen ist \(a<0\)).
Beim Abbremsen ist \(a\) negativ – das sorgt dafür, dass der Bremsweg positiv berechnet wird.
Anschauliche Auswertung von Diagrammen
Im v-t-Diagramm:
- Waagrechte Linie: konstante Geschwindigkeit.
- Steigende Linie: Beschleunigung.
- Fallende Linie: Abbremsen (z. B. beim Bremsvorgang mit \(a < 0\)).
Im s-t-Diagramm:
- Parabel (nach oben gekrümmt): konstante positive Beschleunigung.
- Parabel (nach unten gekrümmt): z. B. bei nach oben geworfenen Objekten (abbremsen, wenden, dann wieder beschleunigen).
Die Steigung im \(v-t\)-Diagramm entspricht der Beschleunigung, die Steigung im \(s-t\)-Diagramm der Geschwindigkeit.
Bedeutung der Vorzeichen
Körper kommen nur dann zum Stillstand oder ändern ihre Richtung, wenn Beschleunigungen „gegen“ ihre Bewegungsrichtung wirken. Im Schema:
- \(a > 0\): Beschleunigung in Bewegungsrichtung (z. B. Anfahren).
- \(a < 0\): Beschleunigung entgegengesetzt; der Körper bremst ab.
Beim senkrechten Wurf (nach oben, dann runter): Die Beschleunigung ist stets \(a = -g\) (gegen die Bewegungsrichtung des Hochwurfs, mit der Bewegungsrichtung des Falls zurück). Die Zeiten „auf“ und „ab“ sind auf derselben Höhe gleich – falls Luftwiderstand ignoriert wird.
Zusammentreffen und Aufholen: Wann begegnen sich zwei Objekte?
Das IMPP stellt hier gerne Aufgaben nach diesem Muster:
- Für jedes Objekt eine eigene Ort-Zeit-Funktion aufstellen (\(x_1(t), x_2(t)\)).
- Schnittpunkt: Gleichsetzen (\(x_1(t^*) = x_2(t^*)\)), nach \(t^*\) umstellen.
Achte auf Geschwindigkeit und Richtung! Für entgegenlaufende Objekte addieren sich die Geschwindigkeiten im Nenner der Zeitgleichung.
Zusammenhang von Kraft, Masse und Beschleunigung
Das zweite Newtonsche Gesetz gibt den grundlegenden Zusammenhang: \[F = m a\]
Je mehr Kraft bei gegebener Masse, desto größer ist die Beschleunigung. Im freien Fall ist \(g\) für alle Körper (ohne Luftwiderstand) gleich, unabhängig von der Masse – weil Gewichtskraft und Trägheitskraft proportional steigen und sich herauskürzen.
Im Staatsexamen wird oft überprüft, ob du die richtige Formel und das korrekte Diagramm aus der Aufgabenstellung herleitest. Parabel = konstante Beschleunigung, Gerade = konstante Geschwindigkeit!
Kompakte Zusammenfassung
- Gleichförmige Bewegung: Weg wächst proportional mit Zeit.
- Gleichmäßig beschleunigte Bewegung: Geschwindigkeit wächst linear, der Weg wächst quadratisch.
- Sind \(v_0=0\) und \(s_0=0\), bleiben nur die „Beschleunigungs-Terme“.
- Die Steigung im \(v-t\)-Diagramm ist die Beschleunigung; die Steigung im \(s-t\)-Diagramm ist die Geschwindigkeit.
- Lese die Aufgaben genau, um die passenden Anfangsbedingungen nicht zu übersehen!
Anwendungsaufgaben und Spezialfälle geradliniger Bewegung
Das IMPP prüft, ob du die Grundformeln flexibel auf verschiedene Anwendungssituationen übertragen kannst – besonders beliebt sind Konstellationen wie Treffen, Aufholen, Teilstrecken mit wechselnden Geschwindigkeiten, kombinierte Bewegungsarten oder spezielle Anordnungen wie die schiefe Ebene oder der Flaschenzug.
Aufholen und Zusammentreffen von Objekten
Typische Frage: Zwei Läufer oder Fahrzeuge bewegen sich aufeinander zu oder starten mit Abstand. Wie lange dauert es, bis sie sich treffen?
- Modell:
\(x_1(t) = x_{10} + v_1 t\)
\(x_2(t) = x_{20} + v_2 t\) - Gleichsetzen:
\(x_1(t^*) = x_2(t^*) \rightarrow t^* = \frac{x_{20} - x_{10}}{v_1 - v_2}\)
Achte auf die Richtung der Bewegung (Vorzeichen) und darauf, wer wen „einholt“. Ist \(v_1 < v_2\) beim Hinterherlauf, wird niemand aufholen.
Je größer der Vorsprung, desto länger musst du aufholen; je größer die Differenz in den Geschwindigkeiten, desto schneller bist du am Ziel.
Wechselnde Geschwindigkeiten und Mittelwert
Wenn du einen Weg aufgeteilt mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zurücklegst, ist die Durchschnittsgeschwindigkeit niemals der Mittelwert der Einzeldaten!
- Immer gültig:
\[v_{durchschnitt} = \frac{strecke\,gesamt}{zeit\,gesamt}\]
Berechne die Einzelzeiten \(t_1 = s_1/v_1\), \(t_2 = s_2/v_2\) usw., dann: \[v_{durchschnitt} = \frac{s_1 + s_2}{t_1 + t_2}\]
Ein besonders häufiger Fehler (den das IMPP gerne prüft): Zwei Strecken gleich lang, aber \(v_1\) und \(v_2\) deutlich unterschiedlich → der langsame Abschnitt wiegt stärker!
Wichtigkeit: Immer Strecke durch Gesamtzeit rechnen, egal wieviele Teilabschnitte oder welches Tempo. Das IMPP testet hier auf Auswendiglernen vs. Verständnis.
Zusammengesetzte Bewegungen (z. B. Laufband-Beispiele)
Oft gefragt: Wie schnell ist eine Person relativ zur Erde, wenn sie auf einem Laufband läuft oder sich zugleich mehrere Bewegungsarten überlagern?
- Vektoren addieren: Bewege dich (z. B. mit 5 km/h auf dem Band), das Band selbst läuft mit 3 km/h → Gesamtgeschwindigkeit 8 km/h in Bewegungsrichtung, 2 km/h, wenn entgegengesetzt.
- Strecke und Zeit für jede Phase separat berechnen, dann alles addieren.
Alltagstipp: Läufst du in einem (fahrenden) Zug, ist deine Geschwindigkeit im Zug und der Zug relativ zur Erde – beide summieren sich.
Rollbewegung und Radgeschwindigkeit
Verlangt das IMPP Berechnungen zur Rollbewegung, hilft ein kurzer Blick auf die Geschwindigkeitsverhältnisse:
- Der Mittelpunkt des Rades bewegt sich mit Geschwindigkeit \(v\).
- Ohne Schlupf: \(v = \omega R\)
- Am Berührungspunkt mit dem Boden ist die Geschwindigkeit null (Gegenzug durch Rolleffekt).
- Am oberen Punkt des Rads: \(2v\) (Summe aus Translations- & Rotationsbewegung).
Deshalb „rollt“ das Rad ohne zu rutschen: Am Kontaktpunkt löschen sich Vorwärts- und Rotationsbewegung genau aus.
Bewegung auf der schiefen Ebene und Flaschenzug
Schiefe Ebene:
Die abwärts wirkende Kraft ist \(F = m g \sin\theta\), wobei \(\theta\) der Neigungswinkel ist. Je flacher, desto weniger Kraft „zieht“ am Objekt.
Flaschenzug:
Mehr tragende Seile → weniger Kraft zum Heben nötig, aber längere Zugstrecke: Bei 2 Seilen brauchst du nur die halbe Kraft, musst dafür aber doppelt so viel Seil einziehen.
Die Hubhöhe ist \(\frac{1}{n}\) der gezogenen Seilstrecke (\(n\) = Anzahl der tragenden Seile).
Egal, wie verschachtelt eine Aufgabe aufgebaut ist – am Ende musst du für jedes Teilstück Geschwindigkeit, Weg und Zeit berechnen und danach zusammenführen!
Fazit: Muster erkennen, Stolperfallen vermeiden
Wer die Grundlagen der geradlinigen Bewegung und ihre mathematischen Zusammenhänge versteht, kann Spezialfälle, Diagrammaufgaben und Kombinationen sicher beherrschen. Das IMPP fragt meist nicht, ob du eine Formel „abspulen“ kannst, sondern ob du sie situationsgerecht einsetzen und die jeweiligen Anfangsbedingungen beachten kannst.
Stelle dir also in jeder Aufgabe anschaulich vor:
- Welche Bewegungsabschnitte gibt es?
- Startet alles bei Null? Sind die Geschwindigkeiten konstant oder gibt’s Beschleunigung?
- Welche Kräfte wirken?
- Laufen Bewegungen nacheinander oder gleichzeitig?
Dann bist du bestens auf alle Variationen vorbereitet, die das Staatsexamen Physik im Bereich geradlinige Bewegung zu bieten hat!
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️