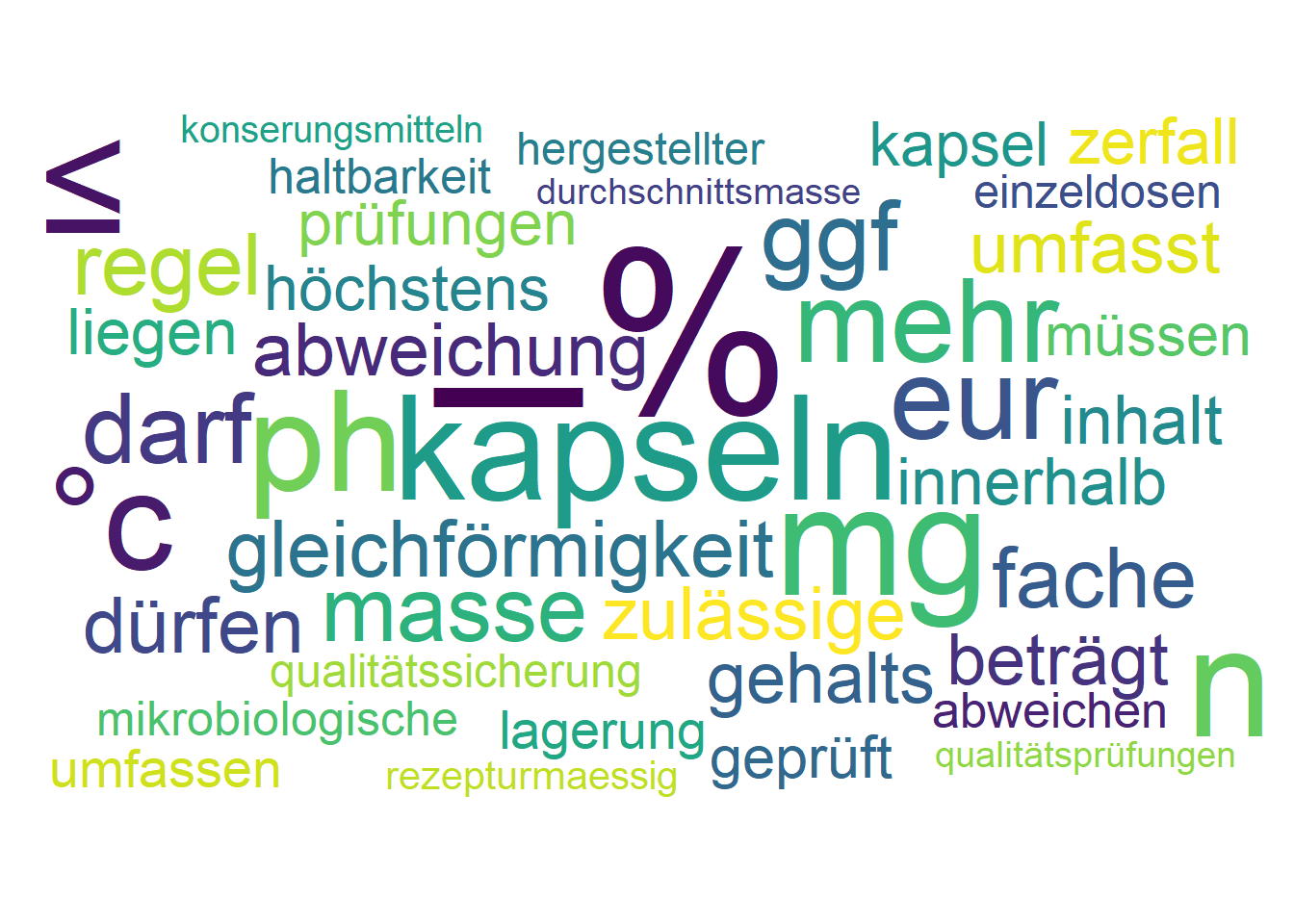Kapseln - Qualitätssicherung
IMPP-Score: 0.4
Qualitätssicherung rezepturmäßig hergestellter Kapseln: Die wichtigsten Prüfungen und ihr “Warum”
Einführung: Warum ist Qualitätssicherung bei Kapseln so enorm wichtig?
Stell dir vor, du bekommst in der Apotheke eine Kapsel, deren Wirkstoffgehalt oder Zerfall komplett unvorhersehbar ist: Mal zu wenig Wirkstoff, mal zu viel, und manchmal löst sie sich gar nicht auf. Das wäre gefährlich und würde das Vertrauen in Arzneimittel erschüttern. Genau deshalb spielen Qualitätssicherungsprüfungen für Kapseln eine so große Rolle: Sie sorgen dafür, dass jede einzelne Kapsel wirkt, wie sie soll – und das ganz unabhängig davon, ob sie industriell oder individuell in der Apotheke hergestellt wurde.
Um die Qualität und Sicherheit zu gewährleisten, greifen wir in der Apotheke auf klar vorgeschriebene Prüfmethoden und Grenzwerte zurück. Die wichtigsten Regelwerke hierfür sind das Europäische Arzneibuch (Ph. Eur.) und die Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO).
Gleichförmigkeit der Masse und Einzeldosen
Was steckt hinter der Prüfung?
Stell dir vor, du bereitest 100 gleiche Kapseln mit dem gleichen Wirkstoff zu. In der Theorie sind die Kapseln identisch, praktisch schleichen sich aber kleine Unterschiede ein – schon allein, weil Pulver nie ganz exakt verteilt werden kann. Die Prüfung der Massegleichförmigkeit soll überprüfen, wie groß diese Unterschiede tatsächlich sind und ob sie noch im Rahmen liegen.
Prüfablauf – Wie läuft das ganze ab?
- Stichprobe ziehen: Es werden 20 Kapseln zufällig ausgewählt.
- Jede Kapsel wiegen: Du bestimmst die Einzelmasse jeder Kapsel.
- Mittelwert berechnen: Alle Massen addieren, durch 20 teilen → das ist die Durchschnittsmasse.
- Vergleich mit Grenzwerten: Jetzt wird für jede einzelne Kapsel geprüft, inwieweit sie von dieser Durchschnittsmasse abweicht.
Welche Grenzwerte gibt es?
Die zulässige Abweichung hängt von der Masse ab:
- Kapseln bis 300 mg: Erlaubt sind Abweichungen von maximal 10% der Durchschnittsmasse.
- Kapseln über 300 mg: Hier liegt die Grenze bei 7,5% Abweichung.
Wichtig: Von den 20 geprüften Kapseln dürfen höchstens 2 außerhalb dieses Rahmens liegen, aber keine einzige mehr als das Doppelte der Abweichung (das wären 20% bei kleinen Kapseln bzw. 15% bei großen!).
Beispiel zur Verdeutlichung
Angenommen, die Durchschnittsmasse deiner Kapseln beträgt 280 mg:
- 10% davon sind 28 mg
- Zulässiger Bereich: 252 mg bis 308 mg
- 18 Kapseln müssen zwischen 252 mg und 308 mg liegen; höchstens 2 dürfen mehr abweichen, aber keine darf außerhalb von 224–336 mg liegen (das ist das Doppelte der Abweichung, also ±20%).
So stellt man sicher, dass der Patient immer einen ähnlichen Wirkstoff bekommt.
Warum gelten lockerere Toleranzen für kleine Kapseln?
Hier ist die Intuition wichtig: Bei sehr kleinen Kapseln (unter 300 mg) machen schon winzige absolute Fehler einen größeren prozentualen Unterschied. Deshalb erlaubt man hier größere prozentuale Abweichungen – während bei größeren Kapseln die Füllmenge und damit auch die Messgenauigkeit steigt.
Was, wenn ein Fehler auftritt?
Wenn beispielsweise drei oder mehr Kapseln außerhalb der Grenze liegen oder eine sogar doppelt so stark abweicht, ist die gesamte Charge durchgefallen. Dann muss geprüft werden, ob ein Herstellungs-, Dosier- oder Wiegefehler vorliegt.
Die Massegleichförmigkeit steht praktisch für: „Bekommen alle Patienten denselben Betrag Wirkstoff?“ Einfache Waagenprüfungen sind im Rezepturalltag daher sehr wichtig – und das IMPP fragt gerne nach, wie genau und warum diese durchgeführt werden!
Gleichförmigkeit des Gehalts
Wann muss sie geprüft werden?
Hier gibt es eine häufige Prüfungsfalle: Nicht immer muss die Gleichförmigkeit des Gehalts geprüft werden! Die Regel ist:
- Nur, wenn der Wirkstoffgehalt pro Kapsel sehr gering ist: Das heißt ≤ 2 mg oder ≤ 2% des Gesamtkapselgewichts.
- Ansonsten reicht die Prüfung der Massegleichförmigkeit aus.
Das liegt daran, dass bei sehr geringem Wirkstoffanteil (also sehr „verdünnt“) selbst kleine Streuungen in der Mischung zu spürbaren Unterschieden pro Kapsel führen können, was per Masse allein nicht erfasst wird.
Was ist der Unterschied zur Massegleichförmigkeit?
- Massegleichförmigkeit prüft: Weicht die Kapselmasse zu stark ab?
- Gleichförmigkeit des Gehalts prüft: Weicht der tatsächliche Wirkstoffgehalt jeder Kapsel zu stark ab?
Für die Gehaltsprüfung müssen die Kapseln erst analysiert werden – also deutlich aufwändiger und chemisch-analytisch anspruchsvoller.
Gehaltsgleichförmigkeit musst du nur prüfen, wenn sehr geringe Wirkstoffmengen (<2 mg oder <2% des Gesamtgewichts) in der Kapsel sind! Das prüft das IMPP sehr gerne ab, insbesondere als klassische Aussage- oder Entscheidungsfragen.
Zerfallsprüfung („Disintegrationstest“)
Was ist das Ziel?
Die Zerfallsprüfung überprüft, ob und wie schnell sich die Kapsel im Körper rasch auflöst und der Wirkstoff überhaupt freigesetzt werden kann. Denn selbst, wenn die Masse stimmt: Bleibt die Kapsel hart wie ein Stein, bringt das dem Patienten nichts!
Prüfablauf nach Ph. Eur.
- Medium: Normales Wasser (bei Bedarf spezielle Lösungen)
- Temperatur: 36–38 °C (entspricht Körpertemperatur)
- Gerät: Spezielles Disintegrationsgerät mit beweglichen Körbchen
- Kapseln einlegen, Start: Die Kapseln werden untergetaucht und sanft hin- und herbewegt.
Soll: Nach maximal 30 Minuten müssen sämtliche Kapseln völlig zerfallen sein.
Spezialfall: Magensaftresistente Kapseln
Manche Kapseln sind extra so gemacht, dass sie erst im Darm, nicht aber im Magen zerfallen (magensaftresistent). In solchen Fällen verwendet man ein Prüfmedium mit pH 1–2 (Magen simuliert), dann mit pH 6–7 (Darm simuliert) – und schaut, ob sie in der „falschen“ Phase stabil bleiben.
Intuition: Warum ist das wichtig?
Stell dir vor, du würdest eine Tablette nehmen, deren Wirkstoff nicht freigesetzt wird, weil die Umhüllung sich nie auflöst. Wirkungslos! Die Zerfallsprüfung ist gewissermaßen ein Schutzmechanismus, der macht: „Funktioniert die Arzneiform überhaupt, wie gewollt?“
Der Zerfall sagt dir, ob der Wirkstoff dem Patienten auch wirklich zur Verfügung steht! Für die Freisetzung ist das ein entscheidender Wert – speziell nachfragen wird häufig, wie lange die Kapseln zerfallen dürfen und welche Ausnahmen es bei Spezialformen wie magensaftresistenten Kapseln gibt.
Weitere Qualitätsprüfungen im Rezepturalltag
Stabilität
Man prüft, ob sich das Arzneimittel unter den angedachten Lagerbedingungen überhaupt hält und nicht vorher zerfällt, verklumpt, schimmelt oder oxidiert.
Feuchtigkeitsgehalt
Zu viel Wasser kann Pulver verklumpen lassen, die Kapselhülle auflösen oder sogar Schimmel begünstigen. Der Feuchtigkeitsgehalt sollte also niedrig sein, was bei Hartkapseln meistens der Fall ist.
Festigkeit
Kapseln sollen stabil, aber nicht zu brüchig und dennoch zum Zerfall bereit sein. Werden sie zu hart, könnten sie nicht (schnell genug) zerfallen; sind sie zu weich, reißen sie bereits bei der Handhabung auf.
Freisetzungsverhalten
Das Freisetzungsverhalten beschreibt, wie schnell und vollständig der Wirkstoff aus der Kapsel im Körper zur Verfügung steht. - Direkter Zusammenhang mit der Zerfallsprüfung, manchmal aber komplexer (besonders bei Retardkapseln).
Mikrobiologische Qualität & Konservierungsmittel
- Trockene Hartkapseln enthalten meist keine Konservierungsmittel – das Wasser fehlt, Bakterien fühlen sich nicht wohl.
- Bei wasserhaltigen Zubereitungen oder sogenannten Mehrfachdosierungen (wo z. B. wiederholt Kapseln entnommen werden), können Konservierungsmittel erforderlich sein.
- Geprüft wird, ob die mikrobiologische Qualität stimmt, also keine (schädlichen) Keime enthalten sind.
Kennzeichnung, Lagerung, Haltbarkeit
- Kapseln müssen ordentlich beschriftet werden: Angaben zu Wirkstoff, Stärke, Hersteller, Herstellungsdatum, Lagerungshinweise etc.
- Die Lagerung beeinflusst Haltbarkeit. Meist: trocken, lichtgeschützt, kühl.
- Die Haltbarkeit richtet sich nach der Stabilität und der Rezeptur, meist einige Wochen bis Monate bei sachgemäßer Aufbewahrung.
Das IMPP integriert gerne Fragen zu richtigen Kennzeichnungen – Stichwort „Wirkstoff, Herstellungsdatum, Aufbrauchfrist“, aber auch zur richtigen Lagerung. Nicht vergessen!
Praktische Zusammenhänge und typische Fehlerquellen
- Die größten Fehler passieren oft beim Abwiegen (falsche Waage, falsch tariert), bei unsauberen Arbeitstechniken (z. B. Pulveranhaftungen) oder beim fehlenden Nachjustieren der Maschine.
- Besonders trickreich: Kleine Dosierungen <2 mg → hier ist der Gehalt, nicht die Masse alleine entscheidend!
Das Wichtigste ist, die Prüfungen mit gesundem Menschenverstand und sorgfältig durchzuführen. Wer weiß, warum geprüft wird und was geprüft werden muss, kann auch in der Klausur schlaue und sichere Entscheidungen treffen – und das mag das IMPP besonders.
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️