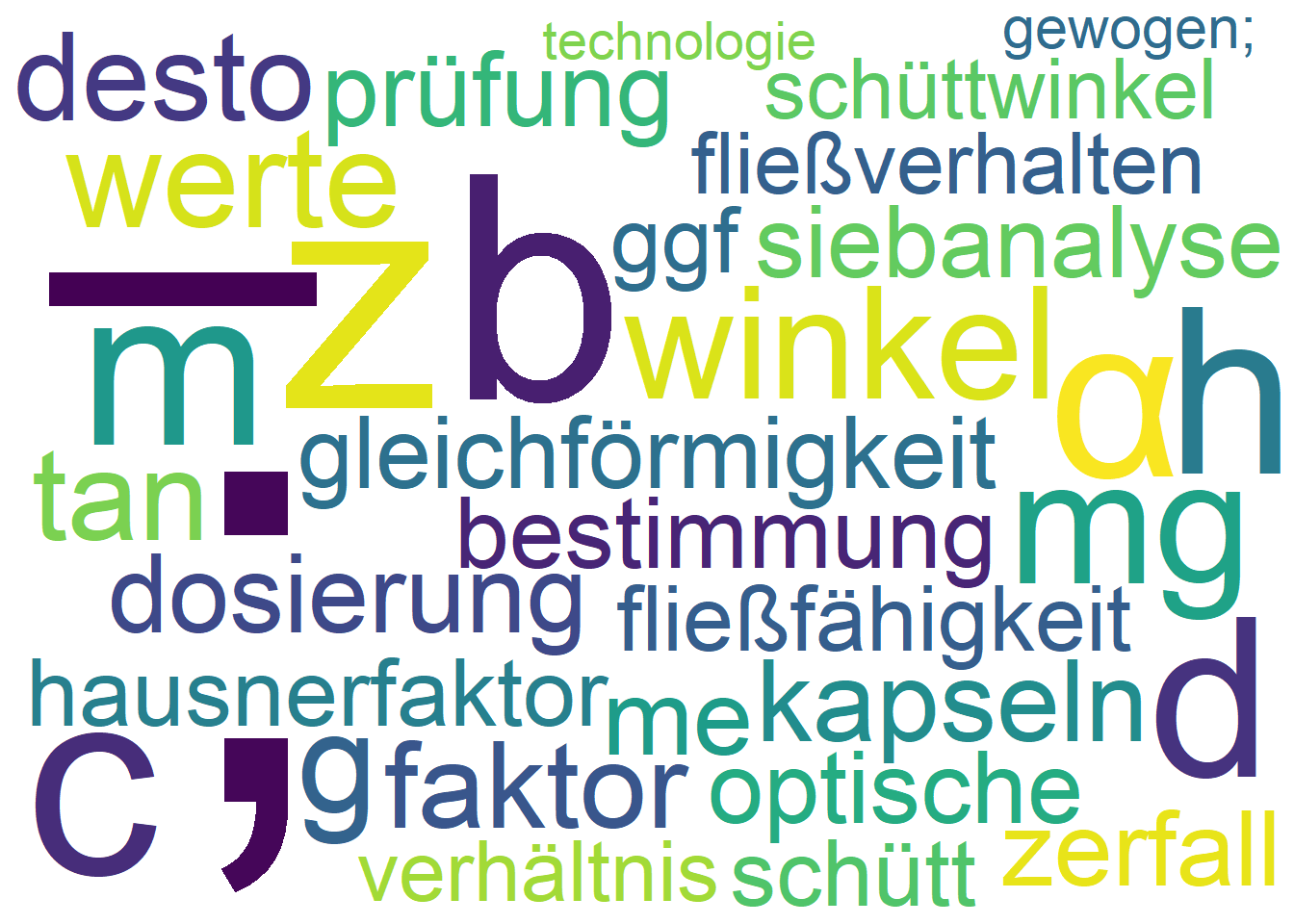Relevante Methoden der pharmazeutischen Technologie
IMPP-Score: 1
Qualitätskontrolle und Methoden der pharmazeutischen Technologie
Intuition und praktische Relevanz: Dosierungs- & Teilchengleichmäßigkeit, Zerfall & Fließeigenschaften bei festen Arzneiformen
Einleitung: Warum ist pharmazeutische Qualitätskontrolle so wichtig?
Wenn ihr Tabletten, Pulver, Granulate oder Kapseln herstellt oder abgebt, erwartet jeder Patient, dass jedes Produkt dieselbe Menge an Wirkstoff und dieselbe Wirksamkeit besitzt – egal, welches einzelne Stück aus der Packung genommen wird. Alles andere birgt große Risiken: Unterdosierung bedeutet mangelnde Wirkung, Überdosierung kann Gesundheitsschäden verursachen. Deshalb setzt die Qualitätskontrolle in der pharmazeutischen Technologie auf klare, nachvollziehbare Prüfkriterien – insbesondere bei der Gleichförmigkeit, Teilchengröße, Zerfallsverhalten und Fließeigenschaften. Diese bestimmen, ob Arzneimittel wirklich sicher, wirksam und vernünftig herstellbar sowie anwendbar sind.
1. Gleichförmigkeit einzeldosierter Arzneiformen (z.B. Kapseln, Teebeutel)
Zentral für die Sicherheit: Die Gleichförmigkeit ist die Garantie, dass jede Einzeldosis – etwa eine Kapsel –, die richtige Menge an Wirkstoff enthält. Die Prüfung erfolgt nach festen Regeln des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.).
Grundlegendes Prüfprinzip
- Warum diese Prüfung?
Damit keine Kapsel zu wenig oder zu viel Wirkstoff enthält – wichtig für die Wirksamkeit (muss „genau treffen“) und für die Sicherheit (keine Über- oder Unterdosierung!).
Wie läuft die Prüfung ab?
- Stichprobe: Von jeder Charge werden üblicherweise 20 Stück (z.B. Kapseln, Beutel) entnommen.
- Bestimmung der Masse:
- Kapseln: Der Inhalt der Kapseln (ohne Hülle) wird gewogen.
- Teebeutel: Nur der Beutelinhalt zählt – der Beutel selbst wird nicht mitgewogen.
- Berechnung der Durchschnittsmasse (\(M\)):
Beispiel \(M = 280~\text{mg}\) (das ist die durchschnittliche Füllmasse). - Toleranzen nach Ph. Eur.:
- Erlaubte Abweichung pro Stück: \(±10\%\) von \(M\) (also hier \(±28~\text{mg}\))
- Für \(M = 280~\text{mg}\): Jedes Stück muss also zwischen \(252\) und \(308~\text{mg}\) liegen.
- Maximal 2 von 20 Stücken dürfen außerhalb dieser Grenze liegen – aber keine um mehr als \(±20\%\) (\(56\) mg).
Von 20 geprüften Kapseln müssen mindestens 18 im Intervall \([252~\text{mg}, 308~\text{mg}]\) liegen (bei \(M=280~\text{mg}\)). Maximal 2 dürfen darüber hinausgehen, aber kein Stück darf kleiner als \(224~\text{mg}\) oder größer als \(336~\text{mg}\) (= \(±20\%\)) sein.
Was passiert, wenn die Abweichungen zu groß sind?
- Durchgefallen: Die Charge darf nicht freigegeben werden. Das Arzneimittel ist dann aus Sicht der Qualität zu unsicher!
Welche Prüfungen sind zusätzlich relevant?
Je nach Wirkstoffkonzentration im Füllgut wird manchmal nicht die Masse, sondern der Gehalt des Wirkstoffes geprüft – besonders, wenn kleine Wirkstoffmengen enthalten sind (\(\leq 2~\text{mg}\) oder \(\leq 2\%\)). Auch die Zerfallszeit muss oft zusätzlich geprüft werden.
Das IMPP fragt gerne Details: Welche Werte sind gültig? Welche Stücke werden gewogen? Merkt euch, dass bei Kapseln der Hüllen-Anteil entfernt wird und bei Teebeuteln ausschließlich der Inhalt zählt.
2. Gleichförmigkeit der Dosierung & Dosiergenauigkeit – kurz und verständlich
Wichtig für alles, was auf Einzelportionen angewiesen ist: Granulate, Pulver, Kapseln, Tees, Nasentropfen. Die Kontrolle der Dosierungsgleichheit sorgt dafür, dass jede abgeteilte Portion – z.B. ein Teelöffel Granulat oder eine getropfte Dosis – konstant die gewünschte Wirkstoffmenge enthält.
Wie wird die Dosiergenauigkeit geprüft?
- Masse- und/oder Gehaltsprüfung: Die abgegebenen Einzelportionen werden auf Masse (und ggf. auf Wirkstoffgehalt) untersucht.
- Mehrdosenbehälter:
Besonders kritisch, weil jeder Portionierungs-Schritt (z.B. Schütteln von Pulver, Dosieren von Nasentropfen) schwanken kann.
Mathematische und praktische Prinzipien – was steckt dahinter?
- Gewicht und Gehalt werden vermessen, der Durchschnitt (Mittelwert) berechnet.
- Die Einzelwerte werden mit festgelegten Toleranzen verglichen.
- Ganz praktisch gesagt: Je konstanter die Einheit, desto verlässlicher die Wirkung.
Beispiel: Für Nasentropfen muss jede Einzeldosis im zulässigen Volumenbereich (und Partikelgrößenbereich!) liegen – das wird durch Wiegen und ggf. Mikroskopie kontrolliert.
3. Teilchengröße und -verteilung: Warum sie entscheidend ist
Stell dir vor, ob du einen Blockzucker lutschst oder feinen Puderzucker: Die unterschiedliche Teilchengröße hat direkt Auswirkungen auf
- Löslichkeit (feine Partikel lösen sich schneller)
- Wirkungsgeschwindigkeit
- Fließeigenschaften (kleinere Partikel rutschen weniger gut, können verklumpen)
- Genauigkeit der Dosierung
Messmethoden: Wie finde ich heraus, wie groß die Teilchen sind?
A) Siebanalyse (Analytisches Sieben)
- Das Pulver wird durch ein Sieb (oder mehrere übereinander) mit definierten Maschengrößen geschüttelt.
- Gröbere Partikel bleiben oben, feinere wandern nach unten.
- Typischer Einsatzbereich: Ab etwa \(30~\mu\)m Partikeldurchmesser. Nicht sinnvoll für sehr feine Pulver.
- Auswertung: Überwiegende Korngrößen und Verteilung werden sichtbar, Zahlen geben an, wieviel Prozent der Probe in welcher Größenklasse liegen.
B) Optische Mikroskopie
- Mit dem Mikroskop kann man direkt sehen und auszählen: Wie viele Teilchen sind kleiner als z.B. \(10~\mu\)m?
- Besonders wichtig für Nachweis der Mikronisation (Pulver < \(10~\mu\)m)
- Grenze: Für gröbere Partikel (> \(30~\mu\)m) unpraktisch, für feine dagegen ideal.
Das IMPP fragt gerne: „Welche Methode nimmt man für feine Pulver?“ Antwort: Für alles unter ca. \(10~\mu\)m immer optische Mikroskopie, für alles über \(30~\mu\)m Siebanalyse. Dazwischen je nach Aufgabenstellung.
4. Schütt- und Stampfdichte, Fließeigenschaften von Pulvern & Granulaten
Was bedeuten Schüttdichte & Stampfdichte?
- Schüttdichte: Die Masse des Pulvers pro Volumen nach lockerem Einfüllen. (Pyknischer Hügel, viele Hohlräume)
- Stampfdichte: Die Masse pro Volumen nach Verdichten (z.B. durch wiederholtes leichtes Klopfen oder Rütteln – die Teilchen rutschen näher zusammen).
Der Hausner-Faktor – ein Universalmaß für das Fließverhalten
\[ \text{Hausner-Faktor} = \frac{\text{Stampfdichte}}{\text{Schüttdichte}} \]
- Interpretation: Je näher der Wert an 1 liegt, desto besser das Fließen!
- Werte um \(1\) bis \(1.20\) → Exzellentes bis gutes Fließverhalten
- Werte über \(1.25\) → Zunehmend schlechter, Pulver verklumpt vielleicht schon
Besonders bei volumetrischer Dosierung (wie beim Füllen von Kapseln) brauchen wir gute Fließeigenschaften. Ein niedriger Hausner-Faktor = zuverlässige, konstante Dosierung.
Woran hapert’s, wenn das Pulver nicht fließt?
Hauptursachen für schlechtes Fließen: - Sehr kleine Partikel (starke Oberflächenkräfte, neigen zu Klumpen) - Sehr unregelmäßige Form (nicht wie kleine Kugeln, sondern „Stacheldraht“-Formen, die sich verhaken) - Feuchtigkeit/Verklumpung
Der Schüttwinkel (Böschungswinkel)
Was ist das?
Man schüttet das Pulver zu einem Haufen – dann misst man den Winkel zwischen der Horizontalen der Unterlage und der Flanke des Haufens (\(\alpha\)).
\[ \tan \alpha = \frac{2h}{d} \]
- \(h\) = Höhe des Haufens
- \(d\) = Basisdurchmesser
Je flacher der Haufen (kleiner Winkel), desto besser „fließt“ das Pulver.
- Werte \(<30^\circ\) → sehr gutes Fließverhalten (praktischer Referenzwert)
- Werte \(>40^\circ\) → schlecht, Gefahr von „Brückenbildungen“
Dynamischer Schüttwinkel
Wenn Pulver kontinuierlich in Bewegung ist (z.B. in einer rotierenden Trommel), wird der sogenannte dynamische Schüttwinkel bestimmt. Auch hier gilt: Je kleiner, desto besser die Fließeigenschaft.
Hausner-Faktor und Schüttwinkel sagen gemeinsam viel über das Pulver – z.B. ob die Produktion zuverlässig und ohne Dosierfehler abläuft.
5. Zerfallszeit/Disintegration: Arzneiformen müssen sich (richtig) auflösen!
Was ist die Zerfallszeit?
Bei festen Arzneiformen (z.B. Granulate, Kapseln) bedeutet Zerfallszeit (Disintegrationszeit), wie schnell die Portion im Medium (meist Wasser) in ihre Bestandteile zerfällt. Kurz gesagt: wie schnell ist die Arzneiform bereit, ihren Wirkstoff freizusetzen?
- Brausegranulate: Zerfall in 5 Minuten in \(200~\text{mL}\) Wasser, \(15\)–\(25^\circ\)C (laut Ph. Eur.)
- Kapseln: Zerfallen meist in simuliertem Magenmilieu (\(36\)–\(37^\circ\)C Wasser), um die rasche Freisetzung des Arzneistoffs zu gewährleisten.
Warum ist das relevant?
- Rasche Wirkung: Muss der Wirkstoff „sofort“ wirken, ist schneller Zerfall gewünscht.
- Stabilität bis zur Anwendung: Manche Inhaltsstoffe zerfallen aber erst im Körper (Schutzwirkung der Kapsel).
- Hydrolyse-empfindliche Wirkstoffe:
Müssen so verpackt werden, dass sie beim Kontakt mit Wasser schnell freigesetzt werden, bevor sie zerfallen.
Wie wird geprüft?
- Definiertes Prüfmedium (z.B. Wasser bei \(36\)–\(37^\circ\)C).
- Arzneiform (z.B. Kapsel, Granulat) wird darin platziert.
- Zeit bis zum vollständigen Zerfall gemessen.
- Bestehen/Nichtbestehen im Vergleich zur erlaubten Zeitgrenze.
Chemisch empfindliche Wirkstoffe (z.B. hydrolyseempfindliche Substanzen, Zytostatika) erfordern klare Aufbrauchfristen. Die Stabilität heißt: Mindestens 90% des Nenn Wirkstoffs müssen über die Lagerdauer erhalten bleiben.
6. Praktische Beispiele & häufige Fallstricke
- Teebeutel: Nur der Inhalt zählt, niemals der Beutel selbst!
- Kapseln: Hülle entfernen, nur das Füllgut zählt.
- Granulate: Schütt- und Stampfdichte, Hausner-Faktor, Korngrößenverteilung – alles zusammen entscheiden über Dosierbarkeit.
- Mikronisiertes Pulver (<10 µm): Nur optische Mikroskopie kann die Verteilung zeigen, Siebanalyse ist hier ungeeignet!
Das IMPP fragt gerne: Wie ist die Toleranz bei 280 mg? Welche Methode für Teilchengröße? Antwort: ±10% Grenze ist 252–308 mg, alles unter 10 µm nur optische Mikroskopie.
7. Besonderheiten je nach Arzneiform
- Kapseln: Teilchengrößenprüfung ist im Arzneibuch KEINE Pflicht – aber Gleichförmigkeit von Masse/gehalt!
- Granulate: Unsichtbare Partikel sind kein Prüfkriterium.
- Halbfeste Zubereitungen (Cremes, Salben): Hier zählt eher Konsistenz (Penetrometrie) oder Gleichmäßigkeit der Wirkstoffverteilung, nicht Siebanalyse oder Zerfallszeit.
8. Häufige Stolperfallen und Tipps für die Prüfung
- Zeigt das IMPP Tabellen zur Gleichförmigkeit, werdet in den Toleranzen sicher!
- Achtet immer auf die richtige Methode zur Prüfung kleiner Partikel.
- Klarheit zu Hausner-Faktor & Schüttwinkel: Gute Fließeigenschaft ist die Basis jeder gut dosierten Arzneiform.
Gleichförmigkeit, Zerfallszeit, Teilchengrößen und Fließverhalten hängen direkt zusammen – besonders in der Praxis, aber auch im Examen. Sicheres Beherrschen dieser Grundprüfungen ist Pflicht für jedes pharmazeutische Tätigkeitsfeld!
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️