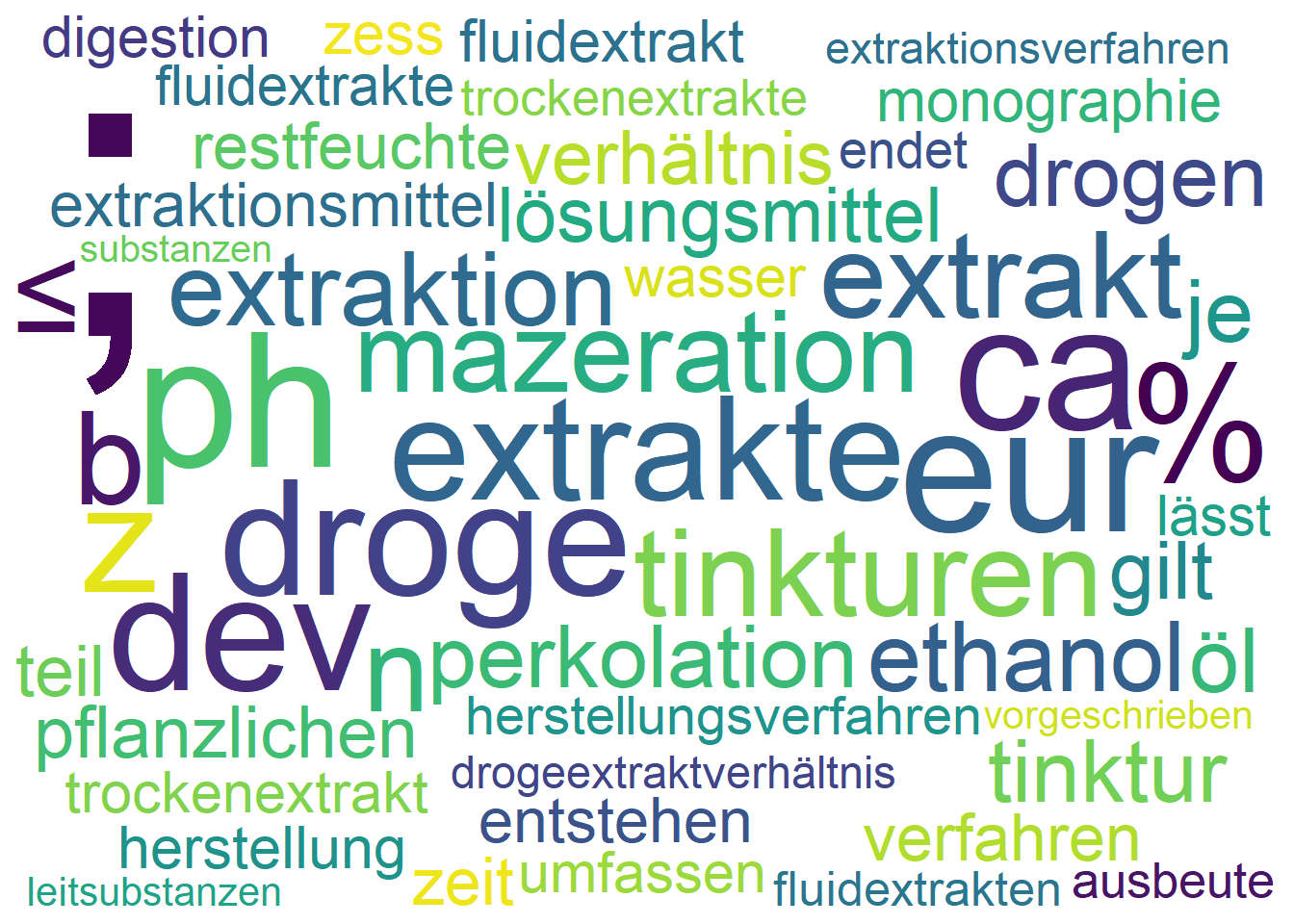Extrakte aus pflanzlichen Drogen
IMPP-Score: 0.9
Extrakte aus pflanzlichen Drogen: Systematik, Monographie und Herstellung nach Ph. Eur.
Extrakte aus pflanzlichen Drogen sind ein zentrales Thema im Bereich der Rezepturarzneimittel – und das IMPP stellt dazu gerne Fragen mit hohem Detailgrad. Damit du dieses Thema nicht nur auswendig lernst, sondern wirklich verstehst, führe ich dich Schritt für Schritt durch Definition, Systematik, Einteilung, Herstellung und Charakterisierung dieser vielseitigen Arzneiformen.
Was ist eigentlich ein Extrakt aus pflanzlichen Drogen?
Ein Extrakt ist – im Kern – das, was du bekommst, wenn du eine Pflanze (die sogenannte Droge, zum Beispiel Kamillenblüten) mit einem geeigneten Lösungsmittel (Extraktionsmittel, z.B. Ethanol oder Wasser) behandelst, um die erwünschten Inhaltsstoffe herauszuziehen. Das Lösungsmittel nimmt die “guten” Stoffe auf, und nach dem Abtrennen der festen Reste bleibst du mit einer oft bunten Flüssigkeit, einem zähen Brei oder einem festen Pulver zurück – dem Extrakt.
Wichtig: Das Wort “Extrakt” sagt erst einmal nur, dass eine gezielte Lösung dieser Inhaltsstoffe aus der Droge stattgefunden hat – nicht, wie flüssig oder fest das Endprodukt ist. Dafür gibt es die genaue Einteilung.
Die Monographie in der Europäischen Pharmakopöe (Ph. Eur.): Die “Spielregeln”
Die Ph. Eur. Monographie Extrakte aus pflanzlichen Drogen beschreibt verbindlich, wie Extrakte herzustellen, zu charakterisieren und zu bezeichnen sind. Sie gibt vor:
- Welche Extrakttypen unterschieden werden
- Welche Herstellungsverfahren erlaubt sind
- Welche Qualitätskriterien zu erfüllen sind (z.B. Restfeuchte, Extraktivstoffgehalt)
- Wie DEV (Droge-Extrakt-Verhältnis) anzugeben ist
- Wie die Extrakte zu benennen sind (z.B. “Trockenextrakt aus Kamille (DEV 4:1), Ethanol 70% (V/V)”)
Die Einteilung: Welche Extrakttypen gibt es – und was ist typisch für sie?
Hier hilft das Bild eines “Konzentrations-Kontinuums”: Extrakte gibt es von flüssig bis ganz fest, je nachdem, wie viel Lösungsmittel letztlich entfernt wird.
1. Tinktur
- Definition: Alkohollösung eines Extrakts, meist mit Ethanol (je nach Pflanzenart 20–70 Prozent)
- Konsistenz: Dünnflüssig, wie ein “Pflanzenlikör”
- DEV: Typisch 1:5 oder 1:10 (bedeutet: 1 Teil Droge auf 5 oder 10 Teile Extrakt)
- Verwendung: Meist zur oralen Einnahme, klassische “Tropfen”
- Herstellung: Häufig Perkolation oder Mazeration
2. Fluidextrakt
- Definition: Flüssiger Extrakt, in dem das Droge-Extrakt-Verhältnis meist 1:1 ist (also: 1 Teil Droge ergibt 1 Teil Extrakt)
- Konsistenz: Flüssig, aber konzentrierter als Tinktur; wirkt fast wie “flüssige Pflanze”
- Verwendung: Grundlage vieler Rezepturen, z.B. für Tees oder Sirupe
3. Dickextrakt (zähflüssiger Extrakt)
- Definition: Halbfester Extrakt, zäh wie Honig oder Sirup
- Restfeuchte: Bis ca. 30 %, also noch deutlich Wasser enthalten!
- Herstellung: Durch Eindampfen (Verdampfen des Extraktionsmittels aus Tinktur oder Fluidextrakt – bleibt ein zähes “Konzentrat” übrig)
- Verwendung: z. B. zur Tablettenherstellung oder äußerlichen Anwendung
4. Trockenextrakt
- Definition: Vollständig eingedampfter, praktisch wasserfreier Extrakt
- Restfeuchte: ≤ 5 %, gut verreibbar, schüttfähig (körniges oder pulverartiges Material)
- Herstellung: Weitere Trocknung von Dickextrakten
- Eigenschaften: Gut standardisierbar und dosierbar – Grundlage vieler moderner Phytopharmaka
5. Ölharz (Resina)
- Definition: Halbfester Extrakt, gewonnen durch Lösen eines Pflanzenharzes in Öl (meist ätherisch oder ein fettes Öl) – nach Verdampfung des Lösungsmittels bleibt ein “Ölharz” zurück.
- Verwendung: Spezialfall, traditionell oder bei sehr harzhaltigen Pflanzen
Presssaft ist kein Extrakt im Sinne der Ph. Eur.! Presssäfte entstehen durch reines “Ausdrücken” der Pflanze – ganz ohne Extraktionsmittel. Das IMPP fragt gerne danach, was als Extrakt zählt und was nicht.
Herstellungsverfahren: Das Herzstück der Extraktherstellung
Hier wird es praktisch – und viele Prüfungsfragen drehen sich genau um die Unterschiede und Besonderheiten!
Grundprinzip: Extraktion
Du möchtest die Inhaltsstoffe der Pflanze herausholen. Das Lösungsmittel löst – je nach seiner Zusammensetzung (ethanolisch, wässrig, …) – bestimmte Stoffe besser oder schlechter heraus.
Welche Verfahren gibt es?
Es gibt eine Grundunterscheidung in:
- Diskontinuierliche Extraktionsverfahren (Batch-Verfahren)
- Kontinuierliche Extraktionsverfahren (fortlaufend)
Diskontinuierliche Verfahren “auf einen Schwung” (Batch-Verfahren):
Hierbei werden Droge und Lösungsmittel einmalig zusammengebracht. Die Extraktion läuft solange, bis (ganz einfach gesprochen) innen und außen gleich viel ist: Der sogenannte Konzentrationsausgleich. Danach ist Schluss, es wird nichts mehr “nachgeschoben”.
Mazeration:
-> Droge wird grob zerkleinert (nicht pulverisiert!), mit Lösungsmittel bedeckt und steht – meist mehrere Stunden bis Tage. Das Lösungsmittel löst, was löslich ist, die Mischung bleibt meist ruhig stehen. Nach Ablauf der Zeit wird der Drogenrückstand abgetrennt.- Vorteil: Schonendes Verfahren, wenig technische Anforderungen
- Nachteil: Unvollständige Extraktion, nicht alles “Gute” wird herausgelöst!
Digestion:
-> Im Grunde eine Mazeration, nur wärmer (Wärmezufuhr unterstützt die Auslösung).Schüttelmazeration:
-> Wie bei der Mazeration, allerdings mit (gelegentlichem oder ständigem) Schütteln/Rühren – das beschleunigt den Prozess, erhöht aber nicht die Gesamtausbeute.Wirbelextraktion / Turboxtraktion:
-> Mechanisch stark unterstützt, z. B. mit Rührwerken oder Turbinen – Ziel ist eine schnellere Extraktion.Remazeration:
-> Mehrere Durchgänge frisches Lösungsmittel auf denselben Drogenansatz – die Extraktausbeute wird erhöht, am Ende werden die Lösungen vereint.
Das IMPP möchte oft wissen: Diskontinuierlich heißt immer, dass Droge und Lösungsmittel zusammen dosiert werden und der Prozess endet, sobald Gleichgewicht erreicht ist! Perkolation ist KEIN diskontinuierliches Verfahren, auch wenn beide Pflanzen und Lösungsmittel verwendet werden!
Kontinuierliche Verfahren: Perkolation und Evakolation
Hier wird die Droge im Behälter fixiert (häufig als Säule). Frisches Lösungsmittel wird kontinuierlich zugegeben, läuft durch die Droge und nimmt ständig “neue” Inhaltsstoffe mit. Das Verfahren läuft so lange, bis der Auszug erschöpft ist – “erschöpfende Extraktion”.
- Perkolation:
- Das Lösungsmittel (häufig Ethanol/Wasser) läuft langsam von oben nach unten durch die Drogenmasse.
- Die frischen Inhaltsstoffe werden kontinuierlich herausgeschwemmt.
- Vorteil: Sehr vollständig, hohe Ausbeute, wenig Rückstände bleiben in der Droge.
- Nachteile: Technisch aufwendiger, längere Prozessdauer.
- Evakolation:
- Ist eine Perkolation unter Vakuum. Das beschleunigt das Verfahren, indem das Lösungsmittel schneller durch die Droge gezogen wird.
- Seltener eingesetzt, eher für industrielle Produktion.
Der wichtigste Unterschied:
Bei der Perkolation läuft frisches Lösungsmittel permanent nach und holt auch die “letzten” Wirkstoffe aus der Droge (“erschöpfende Extraktion”).
Bei der Mazeration endet die Extraktion, sobald drinnen und draußen (Droge & Lösungsmittel) die Konzentrationen ausgeglichen sind.
Weitere Extraktionsarten: Infus und Decoction
- Infus: Überbrühen der Droge mit heißem Wasser (klassisch: Teezubereitung)
- Decoction: Abkochen der Droge mit Wasser (besonders für harte Pflanzenteile wie Wurzeln, Rinden)
Einflussfaktoren auf die Extraktion
- Lösungmittel (Menstruum):
Das IMPP fragt oft nach den Eigenschaften des Lösungsmittels! Wasser, Ethanol oder Mischungen bestimmen, welche Inhaltsstoffe herausgelöst werden. - Temperatur:
Höhere Temperaturen beschleunigen die Extraktion, können aber hitzeempfindliche Inhaltsstoffe zerstören. - Bewegung:
Rühren/Schütteln beschleunigt den Prozess, erhöht aber nicht automatisch die Ausbeute (Stolperfalle!).
Charakterisierung und typische Eigenschaften der Extrakttypen
Restfeuchte:
- Tinkturen/Fluidextrakte: “Lösung”, restfeuchte unrelevant
- Dickextrakte: bis zu 30 % Wasser
- Trockenextrakte: höchstens 5 % Wasser
Dosierbarkeit:
- Trockenextrakte: sehr gut dosierbar (Verpressbarkeit, Pulver)
- Dickextrakte: eingeschränkt (zäh, klebrig)
- Flüssigextrakte: Dosierung über Volumen (Tröpfchen, Messbecher)
Verteilung und Anwendung:
- Flüssige Extrakte (Tinkturen/Fluidextrakte): oral, äußerlich, als Tropfen
- Dickextrakte: für Salben, Pasten, Tabletten
- Trockenextrakte: Tabletten, Kapseln, Teemischungen
Beispielhafte Unterschiede in der Übersicht
| Extrakttyp | Konsistenz | DEV (typisch) | Restfeuchte | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| Tinktur | Flüssig | 1:5 – 1:10 | entfällt | Tropfen, Mischungen |
| Fluidextrakt | Flüssig | 1:1 | entfällt | Rezepturen, Säfte |
| Dickextrakt | Zähflüssig | variabel | ≤ 30 % | Tabletten, Salben |
| Trockenextrakt | Fest | variabel | ≤ 5 % | Tabletten, Kapseln |
| Ölharz | Halbfest | variabel | variabel | Spezialanwendung |
Zusammenfassung: Was solltest du mitnehmen?
- Es gibt flüssige bis feste Extrakte, je nach Menge des verbliebenen Lösungsmittels.
- Die wichtigsten Herstellungsverfahren sind Mazeration (Batch) und Perkolation (kontinuierliche Zuführung).
- Das Verhältnis Droge zu Extrakt (DEV) ist zentral für die Bezeichnung und Standardisierung.
- Unterschiedliche Extrakttypen unterscheiden sich in Konsistenz, Anwendung, Restfeuchte und DEV.
- Die Ph. Eur. Monographie definiert, wie Extrakte richtig zu produzieren und zu deklarieren sind.
- Für Prüfungen: Achte auf die Details im Herstellungsverfahren, besonders auf Stolperfallen wie die Unterscheidung von Tinktur und Infus, oder die DEV-Definition!
Das DEV beschreibt ausschließlich das Verhältnis von eingesetzter Droge zum hergestellten Extrakt (z. B. 1:10 – 1 Teil Droge ergibt 10 Teile Extrakt).
Achtung: Es ist nicht Droge zum Extraktionsmittel, auch wenn das oft verwechselt wird!
Das IMPP stellt hierzu gerne besonders hinterlistige Prüfungsfragen!
Jetzt solltest du die Systematik, Eigenschaften, Unterschiede und den praktischen Herstellungsprozess von pflanzlichen Extrakten durchschauen – und kannst auch in der Prüfung mit den Begriffen und Details spielend umgehen!
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️