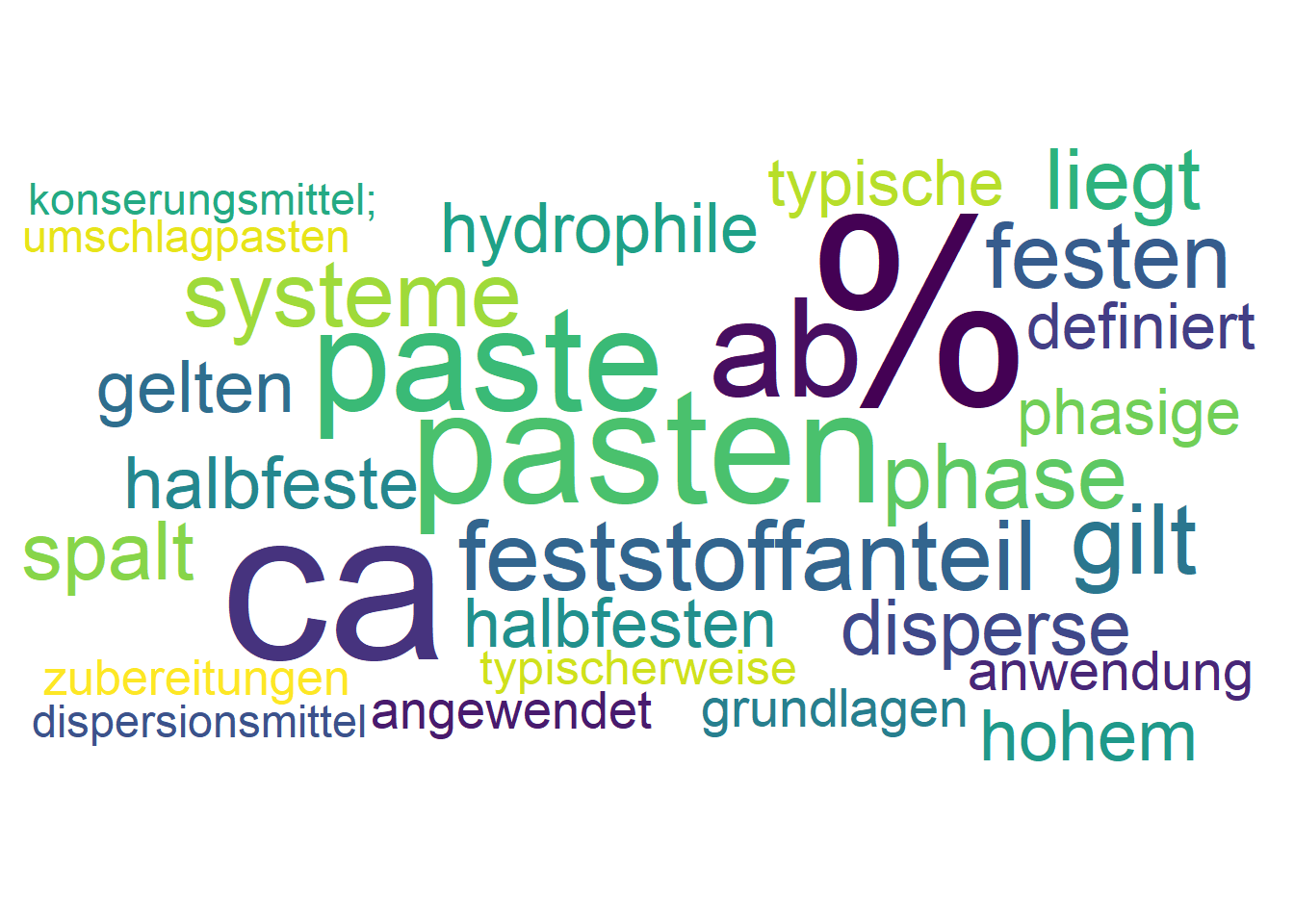Pasten
IMPP-Score: 0.3
Pasten als halbfeste Arzneiform: Verständlich erklärt
Pasten begegnen euch im pharmazeutischen Alltag immer wieder. Damit ihr das Thema nicht einfach nur auswendig lernt, sondern wirklich versteht, nehmen wir uns jetzt Zeit für eine anschauliche und nachvollziehbare Erklärung.
Was sind Pasten überhaupt?
Stell dir vor, du vermischst viel festes Pulver mit einer weichen, salbenartigen Grundmasse – das Ergebnis ist eine Paste. Pasten sind also:
- Halbfeste Arzneiformen: Nicht völlig weich wie eine Creme, aber auch nicht steinhart wie ein Stift.
- Zweiphasige, grobdisperse Systeme: Das heißt, sie bestehen immer aus zwei Phasen:
- Feste, dispergierte Phase: Zum Beispiel feines Zinkoxid-Pulver oder Stärkemehl.
- Halbfestes Dispersionsmittel (Grundlage): Meist eine fetthaltige, weiche Masse wie Vaselin.
Grobdispers bedeutet hierbei: Die festen Teilchen sind im Schnitt größer als 1 µm. Sie sind mit bloßem Auge zwar nicht sichtbar, aber viel größer als die Moleküle in einer Lösung oder Creme.
Die Sache mit dem Feststoffanteil – Abgrenzung zu anderen Zubereitungen
Ein immer wieder beliebter Stolperstein: Ab wann ist eine Zubereitung eine Paste? Die genaue Grenze ist nicht exakt, aber du kannst dir merken:
| Feststoff-Gehalt | Typ |
|---|---|
| Bis ca. 20% | Suspensionssalbe |
| Ab ca. 30% | Paste** |
Dazwischen gibt es Graubereiche, aber im Examen reicht: Ab 30% Feststoffanteil ist es sicher eine Paste. Das ist prüfungsrelevant!
Für die Abgrenzung von Pasten zu Salben gilt: Ab ca. 30% Feststoffanteil spricht man stets von einer Paste!
Aufbau und typische Inhaltsstoffe
Pasten enthalten klassisch:
- Pulverartige Stoffe (z.B. Zinkoxid, Stärkemehl) als feste Phase
- Weiche, halbfeste Grundlage (z.B. Weißes Vaselin, Paraffine)
Ein berühmtes (und gerne geprüftes) Beispiel ist die Zinkpaste nach DAB:
- Zinkoxid
- Stärkemehl
- Weißes Vaselin
Diese Stoffe werden so ausgemischt, dass ein dicker, aber noch streichfähiger Brei entsteht. Ihr merkt: Eine Paste ist dick, schwer verstreifbar, hält gut auf der Haut, rutscht nicht einfach weg und schützt lokal.
Konsistenz und Struktur – was ist “grobdispers”?
Wenn ihr euch eine Paste unter dem Mikroskop anschaut, seht ihr überall kleine, aber noch gut erkennbare Pulverpartikel. Wie schon gesagt, sind diese größer als 1 Mikrometer (µm). Das ist wichtig, weil sich so Pasten von anderen halbfesten Systemen wie Cremes (zumeist “feiner”, kolloiddispers oder molekular dispergiert) unterscheiden.
- Grobdisperse Systeme: Teilchen >1 µm
- Kolloidale Systeme: 1 nm – 1 µm
- Molekulardisperse Systeme: <1 nm
Fließverhalten – Warum Pasten “dicker” sind
Pasten verhalten sich beim Rühren und Verschmieren ein bisschen wie Ketchup aus der Flasche:
- Normale Salbe: Wird beim Anwärmen oder Bewegen dünnflüssiger (“thixotrop”).
- Paste mit viel Feststoff (>50%): Wird beim Rühren fester statt dünnflüssiger! Das nennt man dilatantes Fließverhalten oder Scherverfestigung.
Das ist superwichtig bei der Herstellung: Je mehr du sie rührst, desto fester wird sie. Homogenisieren ist also gar nicht so einfach!
Pasten mit sehr hohem Feststoffanteil können beim Verarbeiten fester werden – das nennt man Scherverfestigung (dilatant). Das erschwert die gleichmäßige Verteilung der Feststoffe!
Grundlagen und Hilfsstoffe – was ist typisch?
Typische Pastengrundlagen:
- Hydrophobe (wasserabweisende) Salben wie Vaselin oder Paraffin. Sie geben Pasten ihre feste, aber dennoch schmierbare Konsistenz.
Wichtige Prüfungsfalle:
Hydrogele (also gelartige, wasserhaltige Grundlagen) sind für klassische Pasten NICHT typisch!
Der Sonderfall: Umschlagpasten
Umschlagpasten sind im Examen ein sehr beliebtes Thema, weil sie sich von „normalen“ Pasten klar unterscheiden:
- Hydrophile (wasserliebende) Grundlagen: Das sind Basen, die viel Wasser aufnehmen können (z.B. Macrogolsalben)
- Einsatz: Sie werden auf die Haut im warmen Zustand aufgetragen.
- In Prüfungsfragen wird erwartet, dass du weißt: Nur hydrophile Grundlagen sind bei Umschlagpasten erlaubt!
Beispiel:
Zinkoxid-Umschlagpaste enthält Zinkoxid in einer hydrophilen Basis und kann zum feuchten Umschlag benutzt werden.
Für Umschlagpasten müssen hydrophile, wasseraufnehmende Grundlagen verwendet werden – das ist ein typischer Prüfungsfact, den ihr sicher wissen solltet.
Konservierung und Stabilisierung – Welche Hilfsstoffe braucht eine Paste noch?
Warum braucht eine Paste Konservierungsmittel?
Weil Feuchtigkeit und organisches Material Mikroorganismen einen Lebensraum bieten, der zur Keimbildung führen kann.
Gängige Konservierungsstoffe:
- Sorbinsäure, Parabene (z. B. 0,1%)
Das sind klassische Substanzen, mit denen du in Prüfungsfragen rechnen solltest.
Antioxidantien (Stabilisatoren):
- Ascorbinsäure (Vitamin C)
- Tocopherolacetat (Vitamin E)
Sie schützen Pasten vor dem “ranzig” werden (Oxidation), wirken aber NICHT konservierend gegen Keime!
Konservierungsmittel (z.B. Sorbinsäure, Parabene) schützen vor Keimen – Antioxidantien (z.B. Ascorbinsäure) nur vor „Ranzigwerden“, nicht vor mikrobieller Kontamination! Polyacrylsäure ist Verdickungsmittel, kein Konservierer – das wird gerne als Prüfungsfalle gestellt!
Wie werden Pasten hergestellt? – Der Dreiwalzenstuhl ganz plastisch
Bei der Herstellung von Pasten ist Homogenisierung das A und O! Es wäre fatal, wenn in der fertigen Paste kleine Pulvernester stecken.
Wie das geht?
Die Grundmasse wird portionsweise mit dem Pulver verrieben. Das Ziel ist eine gleichmäßige Verteilung.
Bei größeren Mengen oder schwierigen Pulvern kommt der Dreiwalzenstuhl ins Spiel (stellt euch eine Art „Nudelmaschine für Pasten“ vor):
- Die Paste wird auf die erste Walze gegeben.
- Sie gelangt durch einen schmalen Spalt zwischen erster und zweiter Walze und wird dadurch fein verteilt.
- Danach folgt ein zweiter, noch engerer Spalt (zwischen zweiter und dritter Walze).
- Schließlich wird die fertige, sehr fein verteilte Paste mit einem Abstreifer entnommen.
Das Ziel: Die Bestandteile sind so gut verteilt, dass wirklich jede Portion gleich aussieht und wirkt.
Anwendungsgebiete und wichtige Prüfungsdetails
- Pasten sind NUR für die äußerliche Anwendung auf der Haut (kutane Anwendung) bestimmt.
- Niemals auf offene Wunden! Auch wenn sie auf der Haut schützen, sind sie nicht steril und dürfen nicht auf verletzte Haut oder Schleimhäute.
- Wirkung: Lokal, meist schützend oder lindern sie leichte Entzündungen und Hautreizungen.
Pasten dürfen nur auf intakte Haut aufgetragen werden – nicht auf offene Wunden! Das erscheint oft in Examen und ist ein „Pflicht-Fact“.
Unterschiede zu anderen halbfesten Systemen – Klar im Blick behalten!
- Suspensionssalbe: bis ca. 20% Feststoff – dünnflüssiger, oft eher als „Salbe“ bezeichnet.
- Paste: ab ca. 30% Feststoff – richtig dick, fest, schwer zu verstreichen; grobdispers.
- Cremes/Gele: enthalten viel weniger Feststoffanteil und meist keine so großen Partikel.
Für die Prüfung ist entscheidend, dass ihr Aufbau, Menge der Feststoffe, Fließverhalten und die spezielle Verarbeitung bei Pasten kennt – und klar die Unterschiede zu anderen halbfesten Zubereitungen benennen könnt.
Damit seid ihr für alle Fragen rund um Pasten als halbfeste, zweiphasige Arzneiform bestens gerüstet – sowohl für die Praxis als auch für jede IMPP-Frage!
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️