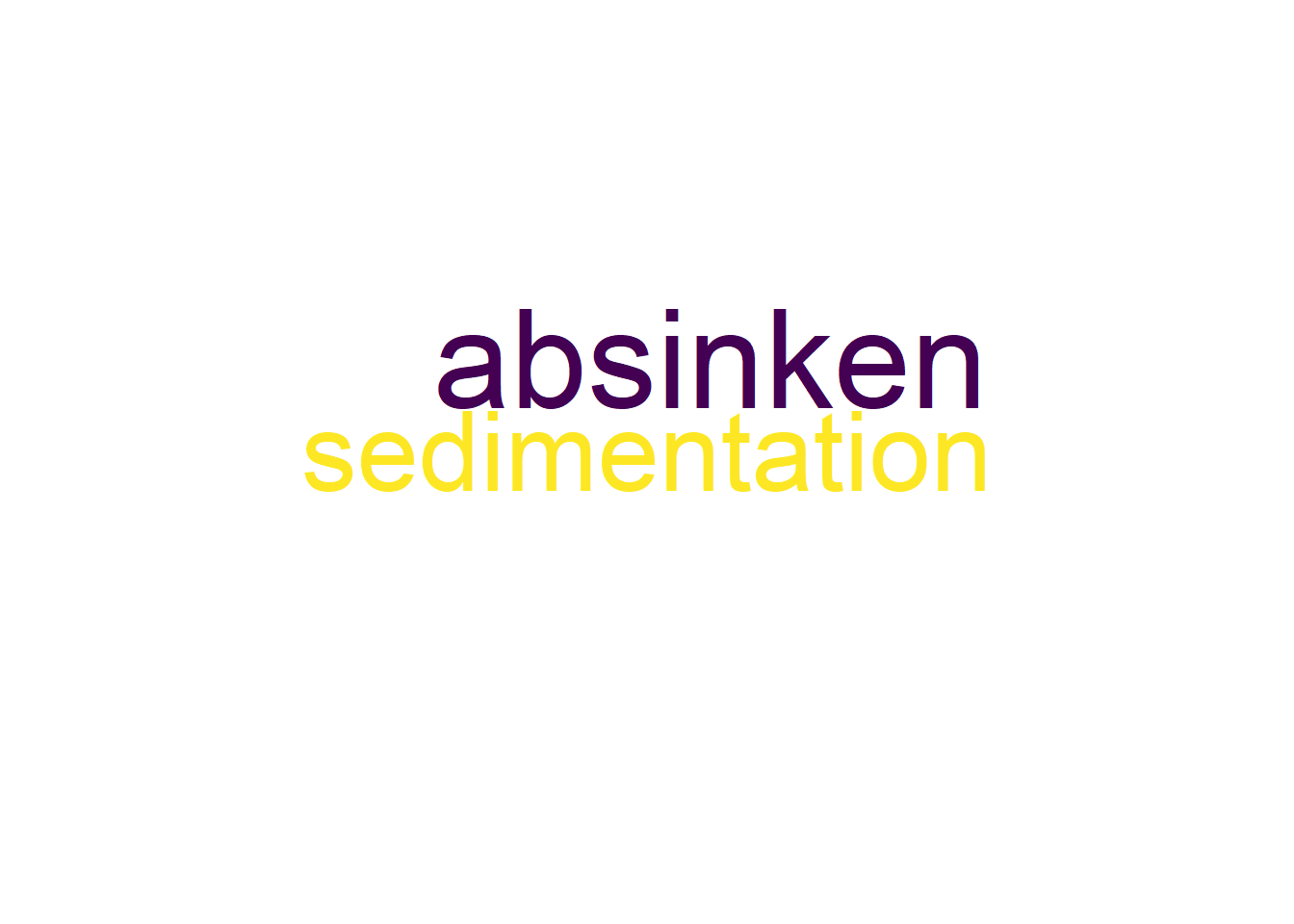Sedimentation
IMPP-Score: 0
Sedimentation – Wie Partikel in Flüssigkeiten absinken
Was genau ist Sedimentation?
Stell dir vor, du schüttelst ein Glas mit Wasser und ein wenig Sand darin. Was passiert? Nach kurzer Zeit siehst du, wie sich der Sand langsam am Boden absetzt. Genau das ist Sedimentation: Das Absinken von festen Teilchen (z.B. Sandkörner) in einer Flüssigkeit (z.B. Wasser) – und zwar weil auf sie eine Kraft wirkt: die Gewichtskraft (also ihr „Eigengewicht“, das nach unten zieht).
Doch was passiert hier „hinter den Kulissen“? Wieso sinken manche Partikel schnell, andere langsam? Und wie kann man das sogar gezielt nutzen, z.B. in Labor oder Technik?
Die Kräfte hinter der Sedimentation
Damit du verstehst, warum dieses Absinken mal schneller, mal langsamer abläuft, lohnt sich ein Blick auf die drei zentralen Kräfte:
Gewichtskraft Diese zieht das Partikel nach unten. Sie hängt ab von der Masse (sprich: Dichte und Volumen) des Teilchens.
Auftriebskraft Die Flüssigkeit drückt dem Partikel entgegen – nach oben. Das kennst du vielleicht vom Schwimmen: Im Wasser fühlst du dich leichter, weil der Auftrieb dich etwas „hebt“. Formal nennt man das das archimedische Prinzip.
Strömungswiderstand (Reibung) Wenn das Partikel durchs Wasser „flutscht“, bremst es dabei die Flüssigkeit weg und wird durch die Viskosität (Zähigkeit) der Flüssigkeit abgebremst. Das ist ähnlich wie beim Versuch, einen Ball durchs dickflüssige Honigglas zu ziehen – dort geht’s auch viel langsamer als in Wasser.
Wie entsteht die Geschwindigkeit beim Absinken?
Am Anfang, wenn das Partikel loslässt („fällt“), beschleunigt es, weil das Gewicht erstmal überwiegt. Mit zunehmender Geschwindigkeit wird aber auch der Widerstand immer größer – irgendwann ist so viel „Bremskraft“ da, dass sich ein Gleichgewicht ausbildet:
- Das nach unten ziehende Gewicht
- Der nach oben drückende Auftrieb
- Der bremsende Strömungswiderstand
Sind diese drei Kräfte genau im Gleichgewicht, hört die Beschleunigung auf, und das Partikel sinkt gleichmäßig schnell weiter. Das nennt man die Endgeschwindigkeit oder terminale Geschwindigkeit.
Die Formel hinter der Sedimentationsgeschwindigkeit – und was sie bedeutet
Vielleicht hast du schon einmal die folgende Formel gesehen:
\[ v = \frac{2 r^2 (\rho_{\text{P}} - \rho_{\text{F}}) g}{9 \eta} \]
Klingt erstmal wie ein „Formelmurks“, aber lass uns das intuitiv aufdröseln. Was bedeuten die Symbole da eigentlich?
- \(v\): Sedimentationsgeschwindigkeit (Wie schnell sinkt das Teilchen?)
- \(r\): Radius des Partikels (Wie groß ist es?)
- \(\rho_{\text{P}}\): Dichte des Partikels (Wie „schwer“ pro Volumen ist das Teilchen?)
- \(\rho_{\text{F}}\): Dichte der Flüssigkeit (Wie „schwer“ pro Volumen ist die Flüssigkeit?)
- \(g\): Erdbeschleunigung (Wirkt immer nach unten, ca. 9,81 m/s²)
- \(\eta\): Viskosität der Flüssigkeit (Wie „zäh“ ist die Flüssigkeit?)
Jetzt zur Intuition: - Je größer das Teilchen (\(r\) groß), desto schneller sinkt es – große Gewichte fallen eben schneller. - Je dichter das Teilchen im Vergleich zur Flüssigkeit (\(\rho_{\text{P}} - \rho_{\text{F}}\)), desto schneller sinkt es. Warum? Der „unterschied“ in den Dichten sorgt dafür, dass die Gewichtskraft größer als der Auftrieb ist. - Je dicker (höhere \(\eta\)) die Flüssigkeit, desto langsamer sinkt das Teilchen – typisches Beispiel: In Honig sinkt alles langsam, im Wasser viel schneller.
Was passiert, wenn zwei Teilchen gleich groß (gleiches Volumen) sind, aber unterschiedliche Dichten haben?
Die Antwort: Beide erfahren den gleichen Auftrieb, weil der Auftrieb nur vom verdrängten Flüssigkeitsvolumen abhängt. ABER: Der mit der höheren Dichte hat mehr Gewichtskraft – die Differenz der Kräfte ist größer. Deshalb sinkt das dichtere Teilchen schneller.
Beispiele, um das Ganze zu veranschaulichen
Kugeln im Wasser: Stell dir vor, du wirfst eine Glaskugel und eine Holzkugel mit gleichem Durchmesser ins Wasser. Die Glaskugel (höhere Dichte) geht schnell unter. Die Holzkugel (niedrige Dichte, sogar leichter als Wasser) schwimmt oben – bei ihr ist der Auftrieb sogar größer als die Gewichtskraft.
Kakaopulver in Milch: Wer kennt nicht das Phänomen, wenn sich am Tassenboden ein Satz Kakao absetzt? Hier haben wir Sedimentation in Alltagspraxis.
Wie kann man Sedimentation beschleunigen? Zentrifugation als Turbo-Trick
In der Medizin oder im Labor dauern natürliche Sedimentationsprozesse oft zu lange. Deshalb nutzt man eine Zentrifuge – das ist nichts anderes als ein „Kreisel“, bei dem die Flüssigkeit und die Teilchen durch schnelle Drehung ganz nach außen (nach „unten“) gedrückt werden. Dieses „nach außen“ fühlt sich an wie eine viel stärkere Schwerkraft.
Dabei gilt die „Kraft im Kreis“:
\[ F_{\text{Z}} = m \omega^2 r \]
- \(F_{\text{Z}}\): Zentrifugalkraft
- \(m\): Masse des Partikels
- \(\omega\): Drehzahl (wie schnell dreht sich die Zentrifuge)
- \(r\): Abstand zur Drehachse
Die Sedimentationsgeschwindigkeit erhöht sich entsprechend! Plötzlich geht das, wofür man sonst Stunden braucht, in Sekunden oder Minuten.
Das IMPP (und auch manch scharfsinniger Prüfer) fragt teilweise, wie sich die Sedimentationsgeschwindigkeit ändert, wenn …
- … die Dichte des Partikels steigt ➔ schneller
- … der Radius des Partikels größer wird ➔ schneller und sogar besonders stark, da \(r\) im Quadrat steht!
- … die Viskosität der Flüssigkeit steigt (z.B. Blut dicker wird) ➔ langsamer
Hier lohnt es sich, die Zusammenhänge wirklich klar im Kopf zu haben!
Wofür nutzt man Sedimentation (und Zentrifugation) im Alltag & Labor?
- Medizin: Die Blutsenkungsgeschwindigkeit misst, wie schnell rote Blutkörperchen absinken (Hinweis auf Entzündungen)
- Technik/Industrie: Kläranlagen lassen Schmutzpartikel „absinken“, um das Wasser zu reinigen.
- Chemie/Biologie: Mit der Zentrifuge trennt man Zellbestandteile, Blutplasma, aber auch Moleküle je nach Größe/Dichte.
Der Unterschied: Normale Sedimentation vs. Zentrifugation
Während bei der normalen Sedimentation die (vergleichsweise schwache) Erdbeschleunigung wirkt, wird sie bei der Zentrifugation durch die schnelle Drehung um ein Vielfaches „verstärkt“. Dadurch sinken (bzw. „fliegen raus“) die Partikel sehr viel schneller.
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️