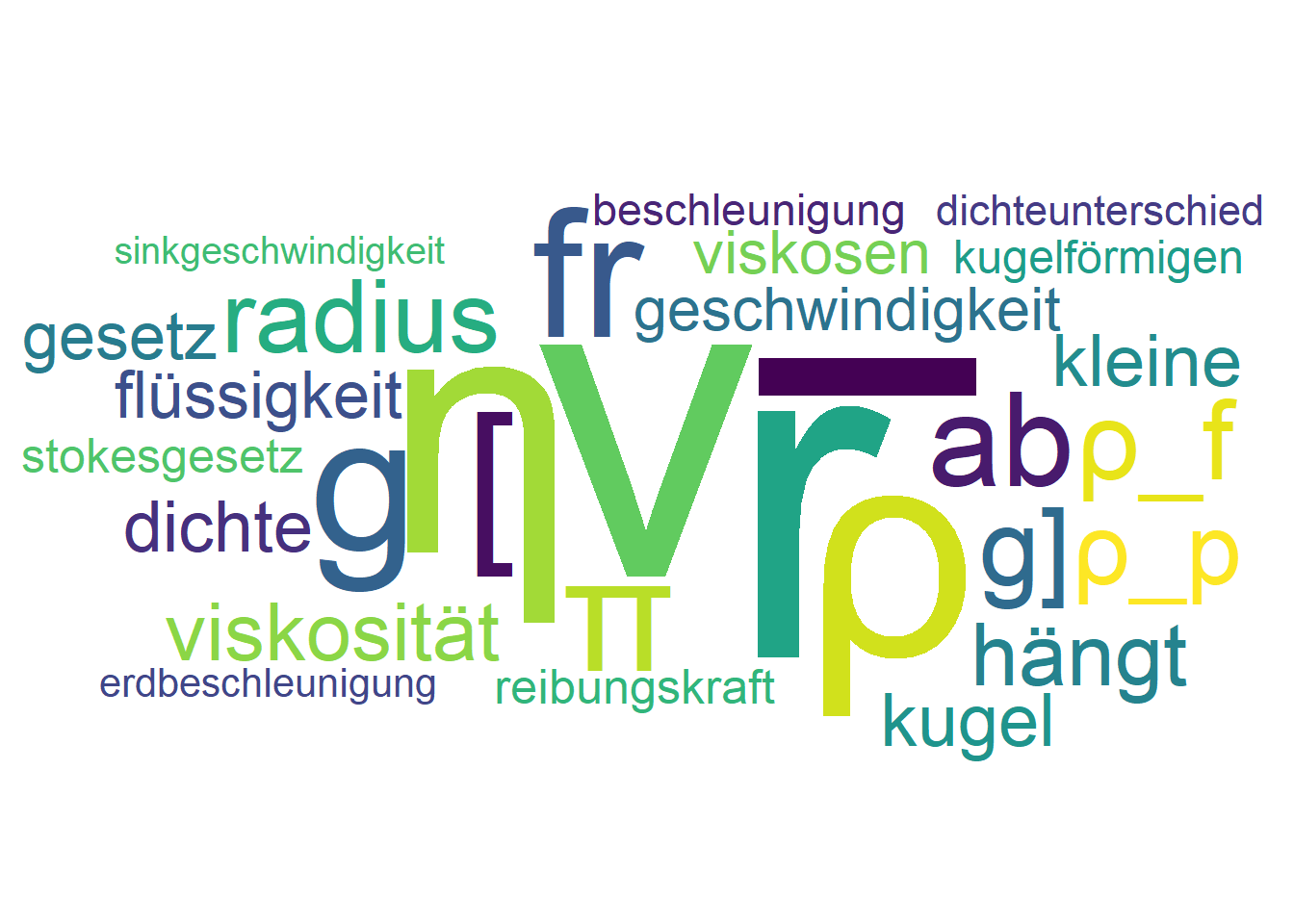Stokessche Beziehung
IMPP-Score: 0.2
Die Stokessche Beziehung – Wie Kugeln in Flüssigkeiten schweben, sinken oder steigen
Stell dir vor, kleine Kügelchen – Sandkörner, Bläschen, Tröpfchen – schweben durch Wasser oder Öl. Vielleicht hast du schon einmal beobachtet, wie ein Sandkorn langsam zu Boden sinkt oder ein Öltröpfchen in Wasser an die Oberfläche steigt. Genau das beschreibt die Stokessche Beziehung: Wie schnell bewegt sich eine Kugel in einer zähen (viskosen) Flüssigkeit – und wovon hängt das ab?
Die Stokessche Gesetz – Was steckt dahinter?
Das Stokessche Gesetz (meist als Stokes-Gesetz bekannt) gibt uns eine Formel, mit der man berechnen kann, wie schnell eine Kugel in einer viskosen Flüssigkeit sinkt oder steigt, wenn nach kurzer Zeit eine sogenannte Endgeschwindigkeit erreicht ist. Das bedeutet: Nach einer kurzen Beschleunigungsphase bewegt sich die Kugel konstant schnell – also ohne schneller oder langsamer zu werden.
Die Formel lautet: \[ v = \frac{2 r^2 (\rho - \rho_0) g}{9 \eta} \]
Was steckt hinter den Symbolen? Schauen wir uns das Schritt für Schritt und anschaulich an:
- \(v\) = Endgeschwindigkeit der Kugel (wie schnell sie dauerhaft unterwegs ist)
- \(r\) = Radius der Kugel
- \(\rho\) = Dichte der Kugel (wie „schwer“ ist das Kugelmaterial pro Volumen)
- \(\rho_0\) = Dichte der Flüssigkeit (wie „schwer“ ist das Flüssigkeitsmaterial pro Volumen)
- \(g\) = Erdbeschleunigung (wie stark zieht die Schwerkraft an der Kugel)
- \(\eta\) = Viskosität der Flüssigkeit (wie „zäh“ oder „widerständig“ ist das Medium)
Intuitiv verstehen: Wie wirkt sich jeder Faktor aus?
Stell dir vor, du wirfst eine große schwere Kugel in Honig – und daneben eine kleine leichte Kugel. Welche sinkt schneller? Genau das erklärt uns das Stokessche Gesetz!
Radius \(r\): Die Geschwindigkeit steigt mit dem Quadrat des Radius (\(r^2\)). Das heißt: Verdoppelst du den Radius, sinkt oder steigt die Kugel viermal so schnell! Das ist eine der wichtigsten Botschaften fürs Examen: Größere Kugeln kommen viel schneller voran.
Dichteunterschied \((\rho - \rho_0)\): Je größer der Unterschied, desto mehr „Zug“ nach unten oder oben hat die Kugel. Ist die Kugel viel dichter als das Medium, sinkt sie schnell. Aber: Ist sie weniger dicht (z.B. ein Öltröpfchen im Wasser), steigt sie nach oben – weil der Dichteunterschied dann negativ ist. Der Dichteunterschied bestimmt also nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Richtung!
Erdbeschleunigung \(g\): Spielt z.B. bei der Zentrifugation eine Rolle. In normalen Situationen ist das die Schwerkraft (etwa \(9,81\,\text{m/s}^2\)), aber eine Zentrifuge „ersetzt“ die Schwerkraft durch eine viel größere Beschleunigung. Das bewirkt: In der Zentrifuge sinken oder steigen Teilchen schneller.
Viskosität \(\eta\): Je „zäher“ die Flüssigkeit, desto schwerer hat es die Kugel. Ein und dieselbe Kugel sinkt in Wasser wesentlich schneller als in Honig! Die Geschwindigkeit nimmt mit zunehmender Viskosität ab – die Flüssigkeit bremst die Kugel stärker.
Noch ein Wort zur Endgeschwindigkeit: Die Kugel beschleunigt nicht ständig weiter, sondern erreicht recht schnell eine Endgeschwindigkeit. Das ist der Punkt, an dem alle Kräfte ausbalanciert sind und kein weiteres Beschleunigen stattfindet.
Die Geschwindigkeit hängt quadratisch vom Kugelradius ab: \(v \propto r^2\). Das bedeutet, wenn du den Radius verdoppelst, wird die Geschwindigkeit nicht doppelt, sondern viermal so groß! Andersherum: Halbierst du den Radius, ist die Geschwindigkeit nur noch ein Viertel so hoch. Das ist ein ganz klassisches Prüfungsdetail: IMPP fragt gern nach solchen Abhängigkeiten.
Für welche Fälle gilt die Stokessche Formel?
Die Formel gilt nur, wenn die Bewegung ruhig und gleichmäßig ist, also wenn es keine Wirbel oder Turbulenzen gibt – das nennt man laminare Strömung oder auch Creeping-Flow. Das ist bei winzigen Kugeln und/oder in sehr zähen Flüssigkeiten gegeben.
- Reynoldszahl (Re) niedrig: Die Zahl gibt an, wie „heftig“ die Strömung um die Kugel ist. Kleine Reynoldszahlen bedeuten: alles fließt gemächlich um die Kugel herum.
- Die meisten Alltagsanwendungen (zum Beispiel kleine Kugeln in Wasser) erfüllen diese Bedingung.
Das Stokessche Gesetz funktioniert nur bei kleiner Kugel, niedrigen Geschwindigkeiten und laminarer Strömung (keine Wirbel!). Bei größeren oder schnelleren Kugeln (hohe Re-Zahlen) gilt die Formel nicht mehr!
Die Stokessche Reibungskraft – Woher kommt der Widerstand?
Wenn sich eine Kugel durch eine Flüssigkeit bewegt, erfährt sie einen Widerstand von der Flüssigkeit. Das ist die sogenannte Stokessche Reibungskraft:
\[ F_{\mathrm{R}} = 6\pi r \eta v \]
Was bedeutet das?
- \(F_{\mathrm{R}}\) = Reibungskraft (wie stark bremst die Flüssigkeit die Kugel)
- \(6\pi\) = Mathematischer Vorfaktor
- \(r\) = Radius der Kugel
- \(\eta\) = Viskosität der Flüssigkeit (wie “zäh” ist sie)
- \(v\) = Geschwindigkeit der Kugel
Anschaulich erklärt
Je größer der Radius, je zäher die Flüssigkeit und je schneller sich die Kugel bewegt, desto größer ist die Bremskraft – sie bremst die Kugel aus. Wichtig: Die Kraft ist linear – also proportional – zu Geschwindigkeit, Radius und Viskosität.
- Dichte spielt dabei keine Rolle: Es ist die Bewegung (nicht das Material!), die ausschlaggebend ist.
Wann pendelt sich die Geschwindigkeit der Kugel ein?
- Die Kugel sinkt nicht immer schneller, sondern wird durch die Flüssigkeit immer stärker abgebremst.
- Nach kurzer Zeit heben sich Gewichtskraft, Auftriebskraft und Reibungskraft auf – die Geschwindigkeit bleibt konstant (Endgeschwindigkeit).
Wie greifen die Kräfte ineinander? Das Kräftegleichgewicht
Um zu verstehen, warum die Kugel irgendwann mit konstanter Geschwindigkeit unterwegs ist, müssen wir das „Kräftegleichgewicht“ anschauen:
- Gewichtskraft (\(F_g\)): Die Schwerkraft, die die Kugel nach unten zieht
- Auftriebskraft (\(F_A\)): Wie stark die Flüssigkeit die Kugel nach oben „drückt“ (eben der Archimedische Auftrieb)
- Reibungskraft (\(F_R\)): Der viskose Widerstand (also die Stokessche Reibungskraft).
Im Gleichgewicht gilt: \[ F_g - F_A = F_R \]
Das bedeutet: Wenn das Gewicht minus Auftrieb genauso groß ist wie die Bremswirkung, bleibt die Geschwindigkeit gleich – das ist die Endgeschwindigkeit.
Anschauliches Beispiel: Ein winziges Luftbläschen im Wasser steigt so lange mit zunehmender Geschwindigkeit auf, bis die Flüssigkeit genauso stark bremst, wie die Dichteunterschiede „schieben“ – ab dann geht’s mit gleichbleibender Geschwindigkeit nach oben.
Die konstante Geschwindigkeit ergibt sich, weil sich Gewichtskraft (nach unten), Auftriebskraft (nach oben) und Reibungskraft (bremst die Bewegung) die Waage halten. Das Gleichgewicht sorgt dafür, dass die Kugel nicht immer schneller wird!
Kugelfallviskosimeter – Wie kann man Viskosität messen?
Eine besonders clevere Anwendung des Stokesschen Gesetzes ist das Kugelfallviskosimeter. Damit kann man herausfinden, wie dickflüssig (viskos) zum Beispiel ein Öl ist.
Wie funktioniert das?
- Man nimmt eine Kugel mit bekanntem Radius und bekannter Dichte.
- Die Kugel wird in die zu untersuchende Flüssigkeit „fallen gelassen“.
- Nach kurzer Zeit sinkt die Kugel mit konstanter Geschwindigkeit (Endgeschwindigkeit).
- Man misst die Strecke (und die Zeit), die die Kugel unterwegs ist, und kann daraus \(v\) bestimmen.
- Setzt man dann \(v\), \(r\), \(g\) und die Dichten in die Stokessche Formel ein, kann man \(\eta\) (die Viskosität) ausrechnen.
Worauf muss man achten? Damit die Messung stimmt, muss die Kugel tatsächlich die Endgeschwindigkeit erreicht haben (sonst ist die Berechnung falsch!). Außerdem muss die Flüssigkeit ruhig sein, keine Strömungen oder Wirbel.
Wird die Geschwindigkeit zu früh gemessen (vor Erreichen der Endgeschwindigkeit), ist die Viskosität zu niedrig bestimmt. Das IMPP fragt häufig nach solchen Messfehlern und nach der Bedeutung der Endgeschwindigkeit!
Zentrifugation – Beschleunigung per Karussell
Manchmal reicht die normale Erdbeschleunigung \(g\) nicht aus, etwa bei sehr kleinen Teilchen. In der Zentrifuge kann man die „effektive“ Beschleunigung (\(g_\mathrm{eff}\)) dramatisch erhöhen. Das steigert die Sink- oder Steiggeschwindigkeit enorm: \[ v \propto g_\mathrm{eff} \] Also: Je schneller und stärker die Zentrifuge dreht, desto schneller passiert die Trennung der Teilchen.
Praxisbeispiele – Wie helfen euch die Formeln im Alltag und im Examen?
- Sedimentation: Warum setzen sich große Teilchen in Flüssigkeiten viel schneller ab als kleine? Und warum dauert es bei kleinen Partikeln oft so lange, bis sie sich z.B. in einer Urinprobe absetzen? Antwort: \(v \propto r^2\). Kleine Teilchen brauchen deutlich länger!
- Viskositäts-Messung: Wenn ihr wissen wollt, wie „zäh“ ein Öl oder eine andere Flüssigkeit ist, lässt sich das direkt im Kugelfallviskosimeter messen – sehr beliebt in Laboren und Prüfungen!
- Blut, Milch & Co: Auch die Trennung von Blutbestandteilen (etwa bei der Zentrifugation) oder die Sahne-Abscheidung in der Molkerei funktionieren nach dem gleichen physikalischen Prinzip!
Was fragt das IMPP besonders gerne?
- Kennt ihr die Bedeutung jedes Parameters in der Stokesschen Geschwindigkeit?
- Wisst ihr, wie die Geschwindigkeit skaliert, wenn Radius, Dichteunterschied oder Viskosität verändert werden?
- Könnt ihr erklären, unter welchen Bedingungen die Formeln gelten (niedrige Re-Zahlen, laminare Strömung)?
- Erkennt ihr typische Messfehler und Anwendungsfehler beim Kugelfallviskosimeter?
- Seid ihr sicher, dass Stokessche Reibungskraft linear von Geschwindigkeit, Viskosität und Radius abhängt, aber nicht von der Dichte?
Visualisiere die Kräfte: So sieht das Kräftegleichgewicht aus
Kugel
↓ Gewichtskraft (zieht die Kugel nach unten)
↑ Auftriebskraft (drückt die Kugel nach oben)
↑ Reibungskraft (bremst die Bewegung der Kugel durch die Flüssigkeit, nach oben gerichtet bei Sinkbewegung)Wenn Gewicht minus Auftrieb gleich der Reibungskraft ist, ist die Kugel mit Endgeschwindigkeit unterwegs.
- Kugelradius quadriert = Geschwindigkeit vervierfacht!
- Viskosität hoch = Geschwindigkeit gering!
- Dichteunterschied entscheidend für Richtung und Tempo!
- Reibungskraft linear abhängig von Geschwindigkeit und Radius, aber nicht von der Dichte!
- Formel gilt nur bei kleiner Kugel und laminarer Strömung!
So – jetzt solltest du die wichtigsten Zusammenhänge rund um das Stokessche Gesetz wirklich verstanden haben und bist bestens gewappnet für die Prüfung.
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️