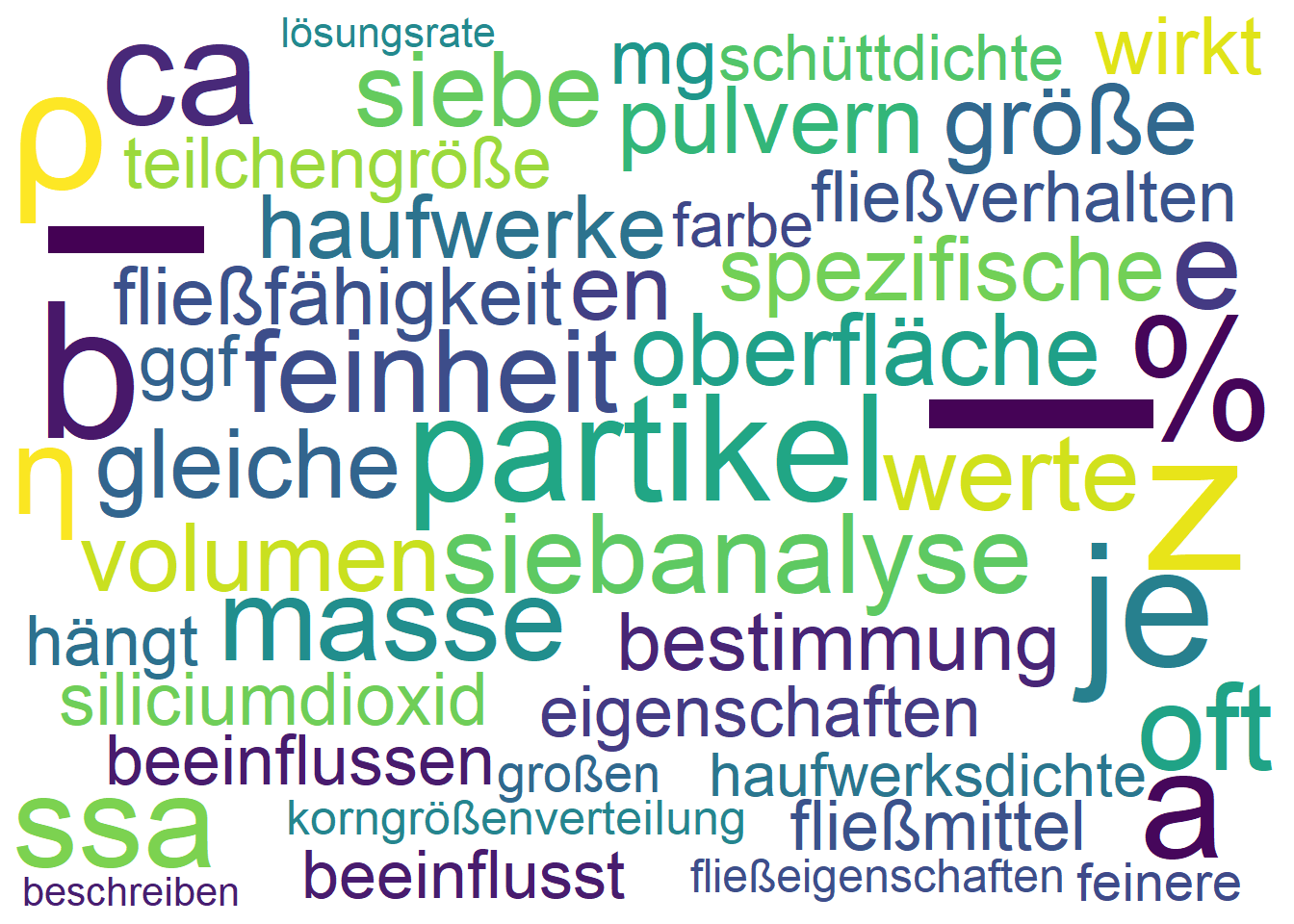Pulver und Granulate - Haufwerke
IMPP-Score: 1.3
Eigenschaften von Haufwerken – Teilchengröße, Haufwerksdichte, spezifische Oberfläche und ihre Bedeutung für Pulver und Granulate
Was ist ein Haufwerk in der pharmazeutischen Technologie?
Beginnen wir mit dem Begriff Haufwerk: In der pharmazeutischen Technologie versteht man darunter eine Ansammlung vieler fester Einzelpartikel – zum Beispiel ein Pulver oder ein Granulat –, die in loser Form (etwa in einer Schale, einem Beutel oder der Kapselfüllung) vorliegen. Die Eigenschaften solcher Haufwerke sind für die Herstellung, Verarbeitung und Anwendung von Arzneimitteln von zentraler Bedeutung.
Ganz wichtig: Das Verhalten eines Haufwerks unterscheidet sich grundlegend vom Verhalten eines einzelnen Partikels. Hier spielen das Zusammenspiel, die Zwischenräume, die Kontaktpunkte und die Wechselwirkungen zwischen den zahlreichen Teilchen eine entscheidende Rolle.
Die wichtigsten Eigenschaften, mit denen man Haufwerke beschreibt, sind:
- Teilchengröße und -größenverteilung
- Haufwerksdichte (bulk density, Schüttdichte)
- Spezifische Oberfläche (SSA)
- Teilchenform und -oberfläche
- Analyseverfahren (z. B. Siebanalyse)
Monodispers/Polydispers & Monoform/Polyform – Was bedeutet das eigentlich?
Diese Begriffe begegnen dir oft in Prüfungen und im praktischen Rezepturalltag:
- Monodispers: Alle Teilchen haben (nahezu) die gleiche Größe.
- Polydispers: Es gibt Teilchen vieler verschiedener Größen.
- Monoform: Alle Teilchen haben (nahezu) die gleiche Form (z. B. alle sind kugelförmig).
- Polyform: Die Teilchen unterscheiden sich deutlich in ihrer Form (z. B. einige rund, andere länglich oder kantig).
🔎 Beispiel – Vorstellung
Stell dir eine Schale mit Glasmurmeln vor: Alle Murmeln sind gleich groß und rund – das ist monodispers & monoform. Legst du kleine und große Kieselsteine gemischter Formen hinein, hast du ein polydisperses & polyformes System.
Graphisch sieht das oft so aus (“G”=groß, “K”=klein):
| Monodispers | Polydispers |
|---|---|
| O O O O | O o O o o O O o |
| (nur große O) | (große O, kleine o) |
| Monoform | Polyform |
|---|---|
| O O O | O □ △ ◯ ○ |
| (nur runde) | (verschiedene Formen: Kreis, Dreieck…) |
Die Teilchengröße – Definition, Messung & Bedeutung
Was bedeutet „Teilchengröße“?
Die Teilchengröße ist DER wichtigste Parameter eines Pulvers. In der Realität sind Teilchen meist nicht perfekt kugelförmig. Man wertet daher die Größe über eine sogenannte Äquivalentdurchmesser – das ist der Durchmesser einer gedachten Kugel, die sich in ihrem Volumen oder ihrer Oberfläche genau wie das reale Teilchen verhält.
- In der Praxis misst man die Partikelgrößenverteilung – also, wie viele große und wie viele kleine Partikel ein Pulver enthält.
- Typische Messverfahren: Siebanalyse für größere Teilchen (gröber 40 µm), Lichtstreuung oder Mikroskopie für feinere Pulver.
- Ergebnis ist meistens ein Mittelwert (z. B. d50 = mittlerer Durchmesser) plus Werte zu Fein- und Grobanteil.
Warum ist die Teilchengröße praktisch so entscheidend?
- Fließfähigkeit: Große, glatte und einheitlich runde Partikel rieseln besser. Kleine und sehr feine Partikel kleben stärker aneinander, was die Fließfähigkeit verschlechtert.
- Homogenität & Mischgüte: Je ähnlicher die Teilchengrößen sind, desto gleichmäßiger lässt sich ein Gemisch herstellen.
- Dispergierbarkeit: Sehr feine Pulver lassen sich zwar besser in Flüssigkeiten verteilen – ABER: Sie neigen stark zur Agglomeration (d. h. „Verklumpen“).
- Löslichkeitsrate (Auflöseverhalten): Kleinere Teilchen lösen sich durch ihre größere Oberfläche schneller auf (wesentlich für viele Arzneimittel!).
Je feiner das Pulver, desto größer ist die Oberfläche pro Masse (SSA). Das löst das Pulver schneller auf – denn mehr Oberfläche heißt mehr „Angriffsfläche“ für das Lösungsmittel!
Ein Beispiel: - Ein großer Zuckerkristall löst sich im Tee langsamer als viele kleine Zuckerkörnchen gleicher Gesamtmenge.
Spezifische Oberfläche (SSA) – die „Angriffsfläche” verstehen
SSA gibt an, wie viel Oberfläche pro Gramm Pulver zur Verfügung steht (Einheit: m²/g). Das ist ganz entscheidend für Reaktionen, Adsorptionsfähigkeit, und vor allem für die Lösungsrate von Arzneistoffen.
- Kleine Partikel → gleiche Masse, aber viel mehr Oberfläche.
- Beispiel: Hochdisperses Siliciumdioxid („Aerosil“) hat extrem kleine Partikel, daher eine SSA von mehreren hundert m²/g!
Wenn du ein Pulver immer weiter zerbrichst, werden seine Teile zwar kleiner und das Volumen bleibt gleich – aber die Oberfläche wird immer größer. Das Multiplizieren vieler kleiner Teilchen führt zu einer enormen SSA.
Wie misst man die SSA?
- BET-Methode: Hier wird Adsorption eines Gases (z. B. Stickstoff) gemessen.
- Gaspermeabilität: Gas durchströmt das Pulverbett, der Strömungswiderstand gibt Auskunft über die Oberfläche.
- Solche Verfahren messen oft die äußere UND innere Oberfläche (bei porösen Stoffen).
- Normale Pulver: 0,1 – 10 m²/g
- Hochdisperses Siliciumdioxid: 200–400 m²/g!
Solche Oberflächen erlauben es, Adsorptionsmittel und Fließhilfen herzustellen (z. B. Aerosil).
Haufwerksdichte („Bulk Density“) & Volumen – worauf kommt es an?
Die Haufwerksdichte, auch Schüttdichte, ist quasi die „Leichtigkeit“ eines Pulvers:
Es ist das Verhältnis aus Masse und dem Volumen, das das ungeordnete (nicht gepresste!) Pulver einnimmt.
\[\text{Schüttdichte (bulk density)} = \frac{\text{Masse}}{\text{Volumen}}\]
- Messung im Labor: Man wiegt die Pulverportion ab und schüttet sie vorsichtig in einen Messzylinder. Das Volumen liest man dann ab.
- Achtung: Je nach Haften, Fließen, „Aushöhlen“ sieht das Volumen sehr unterschiedlich aus!
Sie bestimmt, wie viel Pulver in eine Kapsel passt. Bei der Kapselfüllung geht es um das Volumen – der Platz in der Kapsel ist begrenzt! Pulver mit sehr geringer Schüttdichte (wie „luftiges“ Siliciumdioxid oder voluminöses Laktosepulver) erfordert daher größere Kapselgrößen oder eine Verdichtung.
Unterschied zur „echten Dichte“ (True Density):
- True Density: Dichte des reinen Feststoffs ohne Hohlräume → gemessen z. B. mit Pyknometern.
- Bulk Density: Einschließlich aller Hohlräume und Luft im Haufwerk.
Teilchengrößenverteilung und Packungsdichte – wie beeinflusst das die Praxis?
Kein Pulver besteht aus lauter gleich großen Teilchen. Die Größenverteilung ist entscheidend:
- Monodispers: Alle Teilchen sind gleich groß → viele Hohlräume zwischen den Teilchen → eher „luftig“.
- Polydispers: Kleinere Teilchen füllen die Lücken zwischen den größeren → das Haufwerk wird „dichter“, das Volumen sinkt.
Siebanalyse (praktische Durchführung):
- Pulver wird durch übereinander liegende Siebe verschiedener Maschenweite geschüttelt.
- Über jedem Sieb bleibt eine bestimmte Fraktion hängen.
- So erhältst du die Verteilung der Korngrößen und kannst beurteilen, was für dein Rezepturziel ideal ist.
- Je nach Fragestellung reichen manchmal 1–2 Siebe, für eine genaue Verteilung mehrere Siebe.
Fließverhalten von Pulver und Granulaten: Böschungswinkel, Hausner-Faktor & Glidantien
- Fließfähigkeit heißt, wie gut das Pulver „rieselt“. Wichtige Parameter:
- Böschungswinkel: Du kippst Pulver auf einen Haufen – je steiler der „Winkel“, desto schlechter das Fließen (sehr feine Pulver: hoher Böschungswinkel).
- Hausner-Faktor \[=\frac{\text{Stampfdichte}}{\text{Schüttdichte}}\]
Werte nahe 1: ausgezeichnetes Fließen. Werte > 1,18: problematisch für die Kapselfüllung. - Fließmittel (Glidant): z. B. hochdisperses Siliciumdioxid (Aerosil). Wird zu geringen Mengen zugesetzt (meist 0,1–0,5 %), überzieht Pulverteilchen wie ein Puder und verbessert das Fließverhalten durch geringere Reibung und Kohäsion.
Hochdisperses Siliciumdioxid ist ein tolles Fließmittel, aber: Als Basis eines Pulvers ist es nicht geeignet! Es ist praktisch „luftleicht“ (sehr geringe Schüttdichte) und besitzt kaum Tragfähigkeit.
Tipp: Das IMPP fragt gerne, warum Zinkoxid KEIN Fließmittel ist – die Antwort: Fließmittel sollen die Reibung reduzieren, nicht die Masse „auffüttern“!
Probleme und Risiken: Agglomeration, schlechte Dosierung & Co
- Feine Pulver tendieren dazu, zu verklumpen (zu agglomerieren) – sie fließen dann schlechter, geben keine gleichmäßigen Portionen ab, und es kann bei der Mischung zu Entmischungen kommen.
- Schlechte Fließfähigkeit bedeutet: ungenaue Dosierung, Probleme bei der Kapselfüllung, Inhomogenität und unvorhersehbares Verhalten des Pulvers in der Verarbeitung.
- Falsche Auswahl der Pulvereigenschaften kann dazu führen, dass sich Wirkstoffe beim Mischen entmischen (z. B. unterschiedliche Dichte oder Größe).
Zusammenhang Teilchengröße – Oberfläche – Lösungsgeschwindigkeit
Hier gilt die berühmte Noyes-Whitney-Gleichung:
\[ \frac{dM}{dt} = D \cdot A \cdot \frac{(C_s - C_t)}{h} \]
- \(dM/dt\): Auflösungsrate (wie schnell löst sich der Stoff?)
- \(D\) : Diffusionskoeffizient (wie beweglich sind die Moleküle?)
- \(A\) : Oberfläche! (und hier kommt die Teilchengröße ins Spiel)
- \(C_s\) : Sättigungskonzentration
- \(C_t\) : Gegenwärtige Konzentration
- \(h\) : „Schichtdicke“, die Moleküle überwinden müssen
Heißt für dich: Je feiner das Pulver, desto größer ist \(A\), desto schneller löst sich der Stoff. Gibt es nur grobkörniges Pulver, ist \(A\) klein und die Auflösung langsamer.
Verständnisfragen zum Zusammenhang:
- Wie wirkt sich Mikronisierung auf die Lösungsgeschwindigkeit aus?
- Warum darf man nicht zu viel Glidant zugeben?
- Was passiert mit dem Volumen, wenn man kleine und große Partikel mischt?
Hier ist besonders wichtig: Intuitiv erklären und anschaulich begründen können!
Zusammenfassung der wichtigsten Ansätze
Damit du im Examen und Alltag glänzen kannst, solltest du:
- Die Begriffe monodispers/polydispers und monoform/polyform ohne Zögern zuordnen können.
- Erklären können, wie und warum kleine Partikel zu mehr Oberfläche führen und was das ganz konkret für Lösungsvorgänge bedeutet.
- Wissen, wie man Schüttdichte bestimmt und warum sie für die Dosierung im Praxisalltag entscheidend ist.
- Die Bedeutung von Fließmitteln korrekt einordnen.
Denke immer daran: Für die Kapsel zählt das Volumen, für die Löslichkeit die Oberfläche – und für eine homogene Mischung brauchen die Partikel möglichst ähnliche Eigenschaften in Größe und Dichte!
Siebanalyse und Bestimmung der Teilchengrößenverteilung – Methoden, Interpretation und Bedeutung in der pharmazeutischen Praxis
Warum ist die Korngrößenverteilung so wichtig in der Pharmazie?
Bevor wir uns der Siebanalyse als Methode widmen, gehen wir kurz einen Schritt zurück und schauen uns an, warum wir uns überhaupt für die Größenverteilung von Teilchen interessieren sollten.
Stell dir vor, du mischst verschiedene Pulvern und musst später exakt dosieren, abfüllen, Tabletten pressen oder Suspensionen herstellen. Hier entscheidet die Teilchengröße über ganz wesentliche Eigenschaften, die du für die pharmazeutische Praxis benötigst:
- Fließfähigkeit: Grobe, gleichmäßige Partikel rutschen besser und lassen sich präziser abfüllen. Feine, unregelmäßige oder gar sehr kleine Teilchen neigen dagegen dazu, zu verklumpen oder zu „kleben“, was die Dosierung massiv erschwert.
- Mischgüte: Eine homogene Verteilung verschiedener Komponenten (z. B. Wirkstoff + Füllstoff) wird dann erreicht, wenn Partikel ähnlich groß und schwer sind. Je größer die Unterschiede, desto stärker entmischt sich das System – und die Dosiergenauigkeit leidet.
- Homogenität und Dosierbarkeit: Nicht nur für Kapseln und Tabletten ist das entscheidend – auch für Suspensionen, Infusionen oder Pulver zum Inhalieren. Unterschiede in Korngröße beeinflussen die Gleichförmigkeit der Verteilung in der Endformulierung.
- Sedimentation: Bei Suspensionen gilt: Größere Partikel sinken schneller ab. Feinteiligkeit erhöht zwar die Oberfläche (was die Löslichkeit steigern kann), führt aber auch zu unerwünschter Agglomeration.
- Oberfläche und Auflösung: Je kleiner das Teilchen, desto mehr Oberfläche steht für z. B. das Lösen des Wirkstoffs zur Verfügung.
Das IMPP prüft sehr gerne, wie die Korngrößenverteilung die Eigenschaften eines Haufwerks beeinflusst und wie das in der Siebanalyse widergespiegelt wird!
Einführung in die Siebanalyse: Was macht man da eigentlich?
Siebanalyse ist die Standardmethode, um herauszufinden, wieviel Prozent eines Pulvers aus „großen“ bzw. „kleinen“ Teilchen besteht. Man nutzt dazu eine Reihe von Sieben, die wie eine Pyramide von Grob nach Fein übereinandergestapelt sind.
Grundprinzip:
- Ganz oben das Sieb mit den größten Maschen, darunter immer feinere Siebe.
- Das Pulver wird oben auf die Siebstapel geschüttet.
- Durch Schütteln/Sieben wandern kleinere Teilchen durch die größeren Maschen nach unten und landen auf feineren Sieben.
- Am Ende wird das Material, das auf jedem Sieb bzw. in der Auffangschale verbleibt, gewogen.
Das Endergebnis sagt dir, wieviel Prozent auf welchem Sieb „hängen bleibt“. Daraus lässt sich die Korngrößenverteilung ablesen.
Siebnummer und Maschenweite
Die Siebnummer bezeichnet die Maschenweite des Siebes:
- Angabe immer in Mikrometern (µm) – nicht in mm oder pm!
- Die Zahl (z. B. 355) steht für die lichte Weite der Maschen, also wie groß das größte Teilchen maximal sein darf, um durchzupassen.
IMPP-Typisch gefragt: Die Siebnummer gibt immer die Maschenweite in µm an. Sie steht nicht für den Durchmesser der Drähte oder die Diagonale der Öffnungen!
Praktische Durchführung einer Siebanalyse
Wie funktioniert das im Praktikums- oder Laboralltag?
- Siebstapel aufbauen: Meist werden 1–6 Siebe mit absteigender Maschenweite aufeinander gestapelt, darunter eine Auffangschale.
- Beschicken: Eine definierte Menge Pulver wird oben aufgegeben.
- Siebdauer: Das Ganze wird für 10–20 Minuten (es gibt keine feste Vorgabe) mechanisch oder von Hand geschüttelt – je nach Pulver, spätestens, bis der Durchsatz kaum noch weitergeht.
- Agglomeration vermeiden: Besonders feine Pulver kleben oder verklumpen schnell! Statische Aufladung und Feuchtigkeit können das Problem verstärken. Hier kann man oft durch kleine „Kugeln“ aus Gummi, die mitgeschüttelt werden, oder durch einen Fließmittelzusatz helfen.
Agglomeration, statische Aufladung oder zu kurze Siebdauer führen dazu, dass feine Partikel auf (zu) groben Sieben verbleiben. Das verfälscht die Analyse sehr!
Was fordert das Arzneibuch? – Anforderungen des Ph. Eur.
Wie interpretiert man die Ergebnisse? Und welche Vorgaben macht das Arzneibuch (Ph. Eur.) dazu?
Es gibt zwei grundlegende Herangehensweisen:
1. Feinheitsbestimmung (1–2 Siebe)
- Faustregel: 97 % oder mehr der Probe müssen durch das betreffende Sieb passen (also fein genug sein).
- Alternative (mit zwei Sieben):
- Z. B.: Mindestens 95 % müssen Sieb A passieren (grobe Kontrolle)
- Maximal 40 % dürfen durch Sieb B fallen (Feinanteil-Kontrolle)
2. Korngrößenverteilung (mehrere Siebe)
- Hier bekommt man ein Muster/Profil: z. B. “30 % zwischen 250 und 355 µm, 60 % zwischen 180 und 250 µm, 10 % unter 180 µm”.
Je nach Pulverart, Arzneiform und Verwendungszweck (Tabletten, Kapseln, Suspension, Granulat) gibt das Arzneibuch die passenden Grenzwerte vor.
Für viele Anwendungen gilt: Mindestens 97 % eines Pulvers müssen beim Sieben durch das spezifizierte Sieb passen – das ist einer der Lieblingswerte des IMPP!
Beispielrechnung:
Angenommen, ein Füllstoff soll für eine Kapsel verwendet werden, Siebnummer 180 (180 µm). Für die Feinheitsprüfung gilt dann: - Maximal 3 % dürfen auf dem Sieb verbleiben. - Wenn 20 g Probe eingesetzt werden, dürfen am Ende höchstens 0,6 g Rückstand auf dem Sieb auftauchen.
Das IMPP fragt gerne: “Welche Angaben sind für die Feinheits- und welche für die Korngrößenverteilung gefordert?”
Typische Kennzahlen und ihre Bedeutung
- Mittlere Korngröße: Durchschnittliche Größe, meist gewichtet nach Masseanteil.
- Bandbreite (span): Bereich zwischen größten und kleinsten Teilchen.
- Feinkornanteil: Anteil der sehr kleinen Teilchen (z. B. < 63 µm).
- Monodispers vs. polydispers:
- Monodispers: Alle Partikel nahezu gleich groß. Lässt sich selten vollständig erreichen, aber: solche Pulver fließen i. d. R. sehr gut, mischen sich gleichmäßig.
- Polydispers: Viele verschiedene Größen. Verbessert manchmal die Packungsdichte, erschwert aber die Mischhomogenität.
Mono = gleich / Poly = verschieden. Bei einer monodispersen Probe sind praktisch alle Teilchen gleich groß. Ein Beispiel: Glasmurmeln mit exakt demselben Durchmesser! “Polydispers” ist der Normalfall – wie z. B. Sand am Strand.
Direkter Bezug zur Praxis:
- Kapselfüllstoffe: Müssen gut dosierbar und gleichförmig sein, ansonsten werden die Kapseln unterschiedlich gefüllt.
- Granulate: Hier braucht man oft eine breite Korngrößenverteilung (polydispers), um das optimale Packungsverhalten zu erzielen.
- Pulver zur Rekonstitution (z. B. Antibiotika-Säfte): Zu viele Feinteile = schlechte Fließfähigkeit, zu grob = schlechte Löslichkeit.
Verbindung zu Fließverhalten, Mischgüte und Dosiergenauigkeit
Was haben all diese Zahlen und Analysen mit der gelebten Rezeptur zu tun?
Praktisch:
- Pulver mit engem Kornspektrum (alle Teilchen ähnlich groß) fließen besser, mischen sich leichter und geben präziseres Dosierungsergebnis (= Kapselfüllung, Tablettierung).
- Unterschiedlich große Teilchen setzen sich zusammen, kleine rutschen zwischen große – das verringert das Haufwerksvolumen und kann zu Entmischungen führen.
- Feines Pulver: Hohe Oberfläche, neigen zur Agglomeration → Dosierprobleme!
- Grobes, unregelmäßiges Pulver: Geringerer Feinanteil, oft besser fließend, aber manchmal schlechter zu mischen.
Der Hausner-Faktor: Was sagt er uns?
Der Hausner-Faktor gibt an, wie gut ein Pulver fließt bzw. wie sehr es sich unter Erschütterung verdichten lässt:
\[ \text{Hausner-Faktor} = \frac{\text{Stampfvolumen}}{\text{Schüttvolumen}} \]
- Schüttvolumen: Das Volumen, das das lose Pulver einnimmt, wenn es einfach ohne zu rütteln in einen Messzylinder gefüllt wird.
- Stampfvolumen: Das Volumen, das dasselbe Pulver nach wiederholtem(!) Aufklopfen (Tapping) erreicht, bei dem sich die Teilchen dichter zusammenlagern.
Interpretation:
- Werte nahe 1,00–1,18: Gutes Fließverhalten (das lose Volumen wird durch Stampfen nur wenig kleiner, die Teilchen rutschen gut aneinander vorbei).
- Werte deutlich >1,2: Schlechte Fließfähigkeit, viel “Luft” zwischen Teilchen, viele Hohlräume → oft unregelmäßige Größen, schlecht geformte/klebrige Teilchen.
Je näher der Hausner-Faktor an 1, desto besser das Fließverhalten! Werte über 1,25 sind ein Warnsignal für schlechte Fließeigenschaften, was Dosierungsprobleme verursachen kann.
Typische Fehlerquellen bei der Siebanalyse (und wie du sie vermeiden kannst)
- Agglomeration: Feine Partikel bilden „Klümpchen“, die dann zu groß für ihre eigentliche Größenklasse erscheinen.
- Statische Aufladung: Besonders bei sehr feinen/leichtgewichtigen Pulvern bleiben die Teilchen am Sieb oder aneinander haften.
- Zu kurze Siebdauer: Nicht alle Teilchen erreichen die passende Siebposition, das Ergebnis wird verfälscht.
- Siebe verschmutzt: Rückstände von vorherigen Analysen können das Ergebnis beeinflussen.
Was kann ich mit Siebanalyse-Ergebnissen praktisch machen?
Optimierung deines Prozesses:
- Du siehst, ob du z. B. feiner mahlen musst, wenn der Feinanteil noch nicht hoch genug ist.
- Erkennst, ob ein Fließmittel (wie hochdisperses Siliciumdioxid) zum Einsatz kommen muss.
- Kannst gezielt die Fließeigenschaften beeinflussen: Mehr Grobanteil -> besseres Fließen; Mehr Feinteil -> bessere Homogenität aber ggf. schlechteres Fließen.
Ergänzende Methoden zur Bestimmung der Korngrößenverteilung
Ein Satz zu weiteren Methoden, nur fürs Verständnis und zur Abgrenzung:
- Laserbeugung: Sehr präzise, oft für sehr feine Pulver.
- Sedimentationsverfahren: Besonders geeignet für Suspensionen und feine Partikel.
- Siebanalyse bleibt aber für die meisten pharmazeutischen Anwendungen das Mittel der Wahl – einfach, zuverlässig, praxistauglich.
Verbindung zur Mischgüte und Produktoptimierung
- Durch Kenntnis der Korngrößenverteilung kannst du gezielt Rezepturen verbessern:
- Pulver, die nicht fließen: Mehr Grobkorn, evtl. mit Granulierung nachhelfen.
- Mischung zu inhomogen: Korngröße/Dichte angleichen, ggf. Portionier- oder Siebschritt einbauen.
- Suspension sedimentiert zu schnell: Feinkorn erhöhen, Gelbildner einsetzen.
Zusammenfassung
Feedback
Melde uns Fehler und Verbesserungsvorschläge zur aktuellen Seite über dieses Formular. Vielen Dank ❤️